Über Themen mit A Testberichte
Auf yopi.de gelistet seit 09/2003
Tests und Erfahrungsberichte
-
"Und ER lehrte Adam alle Namen..." (Koran, 2; 32)

25.11.2002, 21:52 Uhr von
Kikakeks
Ich bin Kika, 23 Jahre und wohne seit einigen Jahren in Berlin. Ich verreise gern, mag Sterne b...4Pro:
Interessantes übr die Bildung arabischer Eigennamen
Kontra:
leider lässt sich die arabische Schrift im Yopi nicht darstellen
Empfehlung:
Nein
Der Name ist ein Teil des Menschen. Er sollte schön sein und eine gute Bedeutung haben. Aus islamischer Überlieferung geht hervor, dass der Prophet MuÎammad der Wahl und Bedeutung von Namen großes Ansehen beige-messen hat.
Personen- und Stammesnamen
Für Europäer, die nur einen Familiennamen und oft auch nur einen Vornamen haben, erscheinen die arabischen Namen als endlose Bandwürmer. Die Namen geben meist eine überlieferte Genealogie wieder. Diese mündliche Tradition von Namensweitergaben hatte besonders bei überschaubaren, nichtschriftlichen Volksgruppen Bedeutung, um bei Heirat zu enge Verwandtschaften auszuschließen. So ist es möglich bei Arabern eine Abstammungsgeschichte von fünf bis sechs Generationen im Namen zu erkennen.
Der Personenname ist bei allen Völkern ursprünglich mehr als ein bloßes, hinweisendes Zeichen. Der Name wurde vielfach als Teil des Wesens seines Trägers angesehen. Er identifizierte nicht nur, sondern er konnte seine Träger schützen, ihnen Kraft geben, sie vor Krankheiten schützen, Heil bewirken oder Unheil abwenden.
Besonders deutlich zeigen die arabischen Personennamen diese Anschauung. Ähnliches gilt auch für die arabischen Stammesnamen. Sie gehen im Allgemeinen auf Namen einzelner Personen zurück.
Ihrer Funktion nach lassen sich in der arabischen Personennamengebung von der vorislamischen Zeit bis heute folgende Namenstypen unterscheiden:
1. Der Individualname (alam oder ism alam): Der Eigenname, der dem Kind nach der Geburt gegeben wird.
2. Der Elternname (nasab): Der Name des Vaters oder seltener der Mutter, des Großvaters usf. in aufsteigender genealogischer Folge der Filiation in der Fügung ibn/bint X (Sohn/Tochter des/der X).
3. Der Nachkommenschaftsname (kunya): Der Name von Sohn oder Tochter des Namensträgers in der Fügung abu/umm X (Vater/Mutter des/der X).
4. Das Gentilizium (nisba): Ein Adjektiv, das die Zugehörigkeit zu einem Stamm, Dorf usf. angibt. Es hat immer die Endung –i.
5. Der Beiname (laqab): Ein weiterer Name nach Art eines Spitznamen. Hierunter sind auch Berufsnamen oder Titel (ism mansib)und Pseudonyme oder poetische Namen oder pejorative Spitznamen (nabaz) zusammengefasst.
Geordnet ist der Name in (laqab -) kunya – ism – nasab – nisba (- laqab).
Bsp. eines vollständigen arabischen Namens:
Al-Mubarrad Abu l-Abbas Muhammad ibn Yazid al-Azdi
Al-Mubarrad: Beiname - laqab - "der Abgekühlte"
Abu l-Abbas: Nachkommenschaftsname - kunya - Vater des Abbas
Muhammad: Individualname - ism - der eigentliche Name
ibn Yazid: Elternname - nasab - Sohn des Yazid
al-Azdi: Gentilizium - nisba - vom Stamm der Azd
Dass ein einziger Name alle Einzelelemente enthält, ist eher eine Ausnahme. Grundsätzlich war die Anzahl der Glieder der Ahnenreihe offen. Je nach der Bedeutung einer Person konnten neben dem Vater auch der Großvater, Urgroßvater usw. genannt werden.
Der Form nach ist der arabische Personenname meist ein Nomen (z.B. Asad = Löwe) oder eine Nominalverbindung. Bei vereinzelten Beinamen treten auch ganze Sätze als Namen auf. weiterlesen schließen -
Arzneiformen

25.11.2002, 19:30 Uhr von
Ronja
Hallo Leute, Ich bin Mutter von vier Kindern im Alter von 7 bis 16 Jahren die in fast siebzehn ...Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Nein
Wir kennen zwar unglaublich viele Arzneimittel, aber haben wir uns schon mal damit befaßt,welche Form für welches Arzneimittel wohl die beste ist? Oder welche Formen gibt es eigentlich?
Arzneimittel bestehen aus dem Grundstoff der der Wirkstoff ist und aus Hilfsstoffen.
Man unterscheidet:
- Pulver: Pulver sieht meist weiß aus, wie Mehl.
Der Nachteil an Pulver ist, daß er schlecht zu
dosieren und einzunehmen ist.
- Tabletten: Tabletten entstehen durch Pressen
einer Mischung aus Grund und Hilfsstoffen. Der
Vorteil liegt in der genauen Dosierung und der
leichten Einnahme.Sie lassen sich oft durch eine
Einkerbung in der Mitte leicht teilen.
- Dragee: Ein Dragee ist eine überzogene Tablette.
Der Vorteil:Es läßt sich leichter Schlucken,
Geruch und Geschmack sind gut verpackt. Der
Überzug schützt gut vor Umwelteinflüssen.
Der Nachteil: man kann sie schlecht teilen.
- Tabletten mit Magensaftresistentem Überzug:
Mehrmals überzogene Tabletten, die sich erst im
Dünndarm auflösen und so keine Magenprobleme
hervorrufen können.Auch sie haben meist eine
Einkerbung zum Teilen.
- Retarttabletten: Sie geben den Wirkstoff
verzögert über einen längeren Zeitraum ab.
Der Vorteil ist, daß man solche Tabletten weniger
häufig einnehmen muß, da die
Wirkstoffkonzentration bis über Stunden die
gleiche bleibt.
- Brausetablette: Sie enthält Hilfsstoffe (z.B.
Carbonat, welcher sich im Wasser unter
freisetzung von CO2 Gasen löst). Der Vorteil
ist, man muß nichts festes Schlucken, während
der Nachteil darin liegt, daß der Wirkstoff
Wasserlöslich sein muß.
- Lutschtabletten:Sie sind zur Anwendung in der
Mundhöhle gedacht und haben meist eine lokale
Wirkung.
Sublingualtabletten: werden unter die Zunge
gelegt.
Buccaltabletten: werden in die Backentasche
gelegt.
Zerbeißkapseln: werden im Mund zerbissen.
Der Vorteil ist, daß der Wirkstoff über die
Mundschleimhaut direkt in die Blutbahn gelangt
ohne durch den Magen zu müssen.
- Kapseln: Sie enthalten Pulver, Granulat oder
Flüsssigkeiten. Außen bestehen sie aus Gelantine.
Sie haben auch den Vorteil das man sie gut
schlucken kann. In der Aufbewahrung sind sie aber
wesentlich empfindlicher da sie Feuchtigkeit
ziehen können und der Inhalt klumpig wird.
- Zäpfchen: hier wird unterschieden: rectal (in
den Poppes), vaginal ( in die Vagina).
Sie bestehen auch aus dem Grundstoff und dem
Hilfsstoff welcher durch die Körpertemperatur
schmelzen muß. Sehr gut Anzuwenden bei alten
Menschen, Säuglingen, Kleinkindern, Bewußtlosen
und bei Magenunverträglichkeiten.
Der Nachteil der Zäpfchen ist die
Temperaturempfindlichkeit.
- flüssige Arzneimittel: Tropfen, Säfte, Infusions.
und Injektionslösungen bestehen aus dem Wirkstoff
und Lösungsmitteln.
Der Vorteil: Es kommt schon gelöst im Magen oder
Körperinneren an. Der Nachteil: sie sind meist
nicht lange haltbar.(Angefangene Tropfen oder
Säfte meist nur 14 Tage nach öffnen der Flasche)
- Emulsion: Flüssiger Wirkstoff in flüssiger Form
(Wasser oder Oel)
- Salben: Werden auf einer Fettgrundlage
hergestellt.
- Cremes: Weich in der Konsistenz, wasserhaltig
und meist nicht fettend
- Pasten: sehr hoher Anteil an Fettstoffen
- Gele: Sehr viel Wasser und Geliermittel weiterlesen schließen -
Das Beste was ein Apfel werden kann ...

20.11.2002, 10:03 Uhr von
Sparfux
Nach langer Abwesenheit versuche ich einen Neustart bei Yopi. Ich freue mich hier alte Bekannte a...Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Nein
Hallo Ihr Lieben,heute möchte ich Euch meinen Lieblingsapfelwein vorstellen:
Der Äppelwein gehört zu Hessen, wie das Weizenbier zu Bayern. Der Apfelwein ist das " Nationalgetränk" der Hessen. Hier in Hessen nennt man den Apfelwein entweder Äppelwoe, Äppler oder Stöffche.Es gibt viele Sorten, mein absoluter Liebling ist der Äppelwein von Possmann.
1881 kelterte Gründer Philipp Possmann im Frankfurter Vorort Rödelheim zum ersten mal in seinem Gasthof Apfelwein, seid dieser Zeit stellt die Familie Possmann den Apfelwein in Frankfurt her.
Der Slogen " Das Beste was ein Apfel werden kann " ist in Hessen sehr bekannt.Da Possmann ein echt Frankfurter Apfelwein ist, wird er natürlich auch in der Frankfurter Umgebung am häufigsten getrunken.
Es gibt viele verschiedene Variationen,
wie man einen Apfelwein trinken kann :
Man kann Ihn natürlich pur trinken.
Apfelwein mit Wasser gemischt ( Verhältniss ca. 60/40)ist ein sauer Gespritzter.
Apfelwein mit Zitronenlimo ( Verhältniss ca. 60/40)ist ein Süß Gespritzter.
Man kann an kalten Wintertagen den Äppelwei auch heiß genißen.
Schmeckt besonders lecker auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt.
Im Sommer ist er der ideale Durstlöscher.(dann natürlich gespritzt),wir wollen ja nicht betrunken werden ;-)
In Frankfurt gibt es spezielle Äppelwein Kneipen z. B. in Sachsenhausen, wo das Stöffche natürlich besonders gut schmeckt.Dort wird der Apfelwein in sogenannten Bembeln gereicht.
Jedes Jahr wird in Hessen die Apfelwein-Königen gekürt.
Die dann bei zahlreichen Veranstaltungen wie z.b beim RöDELHEIMER ÄPPELWOI-FEST oder dem MUSEUMSUFERFEST den Apfelwein präsentiert.
Man trinkt den Apfelwein aus speziellen Gläsern den sogenanten Gerippten. Das sind Gläser ähnlich dem Wiskygläsern ;-)nur etwas größer.
Der Apfelwein von Possmann hat 5.5% Alkohol.
Die Flasche 1 Liter kostet ca. 2 €.
Der etwas saure Geschmack ist sicher gewöhnungsbedürftig.
2 -3 Gläser am Abend sind gut für die Verdauung.*g*
Ich hoffe ich habe euch mit meiner kleinen Apfelweinkunde auf den
Geschmack gebracht.
Na dann prösterchen !!
Danke fürs Lesen und Bewerten
Bis dann Euer ( Apfelwein trinkender ) Sparfux ;-) weiterlesen schließen -
Der Verteidigungshaushalt und die kalte Jahreszeit
Pro:
es kann schon helfen
Kontra:
irgendwie erwischt es einen trotzdem immer
Empfehlung:
Nein
Der Verteidigungshaushalt und die kalte Jahreszeit
Feierabend. Vor mir liegt die Novemberausgabe meiner geliebte Apotheken-Umschau. Das Gesundheitsmagazin für den Kunden erscheint immer am 1. und 15. eines Monats und ist in den Apotheken kostenlos zu erhalten. Die aktuelle Novemberausgabe titelt reißerisch:
Fit für den Winter – 33 Tipps für eine starke Abwehr.
Ich habe mich zunächst gefragt, welche Marketing-Strategie denn wohl dahinter steckt, dass die Apotheke mir vorbeugend vermitteln will, welche Maßnahmen denn dazu führen, dass ich keine Medikamente brauche. Ich habe im Impressum nachgesehen, finde leitende Redakteure, die selbst Apotheker sind, dort finde ich weiterhin einen fachwissenschaftlichen Beirat und sehr dezent und indirekt Hinweise auf die Pharmaindustrie.
Gut, nach erster Durchsicht ist die Zeitschrift sehr informativ, gespickt durch Werbung von Paracetamol-ratiopharm 500 über Klosterfrau Melissengeist bis hin zu Baldrian-Dispert und nach meiner Einschätzung auf die Generation ab 40 Jahre aufwärts (steil aufwärts) ausgerichtet. Allerdings gibt es den kleinen Psychotest „Sind Sie überzeugend“ ebenso wie eine Rätselseite für die ganze Familie und als Krönung den obligatorischen Gutschein von LIFTA - Der Treppenlift. Also folgern wir: für jeden was dabei. Der Apothekenkunde bekommt Informationen zur Gesundheit und jede Menge Werbung für den Fall der Fälle.
Nun aber zum Thema. Wie können wir nun den körperlichen Verteidigungshaushalt aufrüsten, um die Abwehrkräfte für die unweigerliche Erkältungs-, Grippe- und Virenüberfälle zu stärken? Die Arzneimittelhersteller veröffentlichen, dass die lieben Deutschen jährlich 850.000.000,- Euro allein für Hustensaft und Erkältungspräparate ausgeben. Rechnet man den krankheitsbedingten Arbeitsausfall und die verminderten Leistungen der Erkrankten hinzu, so errechnet sich eine nicht mehr zu beziffernde Summe.
Was ist folglich als Prophylaxe wirksam?
Als erstes lese ich etwas sehr unangenehmes. Jeden Morgen eine Wechseldusche, von 40 Grad Celsius nach einer Minute auf 15 – 20 Grad kaltes Wasser runter und dann auch noch von unten nach oben. Danach wird empfohlen, ab und an mal in die Sauna zu gehen, um schließlich im Sinne des alten Kneipp Wassertreten in kalten Wasser (schon wieder nur 15 bis 20 Grad) anzubieten, was ja wohl jeder in der heimischen Badewanne realisieren könne. Soweit war mir das alles schon klar, bevor ich diese Apotheken-Tipps gelesen habe. Ich mag keine Sauna, ich hasse kalte Duschen am Morgen und komme mir vollkommen bescheuert vor, wenn ich zukünftig präventiv in der Badewanne spazieren gehen soll.
Interessanter ist da schon der Tipp, dass alle zwei tage ca. 30 Minuten leichter Sport reicht. Für mich als Sportmuffel erreicht ein Spaziergang den gleichen Effekt. Das ist schon einmal prima, schließlich gehe ich täglich aus dem Rathaus zum Mittagessen und morgens vom Parkplatz ins Büro und abends wieder zurück.
Ich will die geneigte Leserschaft jetzt auch nicht überstrapazieren und die noch ausstehenden 28 Tipps referieren. Doch aus gegebenem Anlass müssen noch einige wichtige Gesundheitstipps genannt werden. Man glaubt es kaum, aber Rauchen soll man gar nicht. Wer raucht, soll es doch tatsächlich aufgeben. Gut, denke ich mir, das mach ich ja nun schon ganz tapfer in der fünften Woche und zwar ohne die angedeuteten guten Ratschläge der Apotheken-Rundschau da mit geeigneten Präparaten unterstützend nachzuhelfen.
Da ist es dann ja schon wieder beruhigend, dass Sex die Abwehrkräfte steigert. Allerdings, so folgt die Enttäuschung auf dem Fuße: Mehr Sex als zweimal pro Woche kehrt den Effekt um. Die Apotheken-Rundschau vergewaltigt in diesem Kontext Martin Luther und zitiert:
„In der Woche zwier schaden weder ihm noch ihr ...“
Und für die Gesundheitsapostel gibt es abschließend noch eine Adresse.
Unter www.GesundheitPro.de findet der interessierte Leser so einiges Wissenswerte zum Thema.
Last but not least noch der unglaubliche Tipp Nummer 33: Lachen ist gesund!
Nehmen wir nicht immer alles so ernst. Ein freundliches Lächeln oder auch ein herzhaftes Lachen fördert die positive Einstellung von uns selbst zu unserem Organismus.
Und für alle, die jetzt schon ein schlechtes Gewissen haben. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein übermäßiger Internet-Konsum Erkältungskrankheiten fördert und die potentiellen Viren über die Maus ins Handgelenk in die Atmungswege übergreifen.
Indigo wünscht weiterhin Gesundheit und ggf. gute Besserung. weiterlesen schließen -
Adventsalphabet

18.11.2002, 12:52 Uhr von
willibald-1
Zur Zeit selten hier. Gegenlesungen dauern daher - kommen aber!Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Nein
Sind ja jetzt nur noch zwei Wochen bis dahin - und vielleicht findet der eine oder andere ja einen nette Anregung für die bevorstehende "stille Zeit".
Ich persönlich finde es immer schade,wenn der Advent in Hektik fast "untergeht", und deshalb versuche ich schon mal, mich darauf vorzubereiten. Vielleicht kann ich dann die Hektik etwas "entzerren".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Adventskalender
Man benutzt ihn dazu, die Zeit bis Weihnachten zu "verkürzen". Das geht so: Das erste Türchen öffnet man am ersten Dezember. Morgens beim Aufwachen freut man sich schon darauf, gleich das nächste Türchen zu öffnen und ist schon gespannt, was sich wohl dahinter verbirgt. Damit man immer das richtige Türchen öffnet, sind diese durchnumeriert. Es gibt 24 Türchen. Je mehr Türchen schon geöffnet sind, desto näher ist Weihnachten. Das ist sehr praktisch, weil man weiß, daß man spätestens dann die Läden nach Weihnachtsgeschenken durchstöbern muß, wenn man das 23. Türchen geöffnet hat. Ansonsten dient der Kalender aber überwiegend zur Freude.
Barbaratag
Am vierten Dezember ist Barbaratag. Das ist der Tag, an dem die Barbaras dieser Welt Namenstag feiern. Außerdem schneidet man an diesem Tag die Barbarazweige. Geeignet sind vor allem Kirschbaumzweige, aber es gehen auch andere. Die Zweige werden in eine Vase mit Wasser gestellt. Und wenn man eine ausreichend warme Wohnung hat, blühen die Zweige an Weihnachten. Das ist ein schönes Symbol für das Aufbrechen neuen Lebens an Weihnachten.
Christrose
Kennst Du diese wunderbare Blume? Sie blüht gerade jetzt, wo man eigentlich denkt, daß die ganze Natur Winterruhe hält!
Dunkelheit
Daß das Weihnachtsfest in den Winter gelegt wurde ist ja kein Zufall. "Das Licht kam in die Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen."
Engel
"Einen Engel bemerkt man immer erst, wenn er schon gegangen ist", habe ich neulich gelesen. Da ist was dran, oder?
Freude
Das halte ich eigentlich für ziemlich wichtig. Wir sprachen darüber, daß wir gar nicht so richtige weihnachtliche Stimmung erleben. Vielleicht, weil wir so wenig Vorfreude haben? Oder gibt es nur noch so wenig, über das wir uns richtig freuen können? Machen wir einfach unsere Augen nicht richtig auf für die kleinen Dinge, die einfach schön sind?
Glocken
Ich erinnere mich, daß wir Schallplatten mit Weihnachtsliedern hatten, auf denen man mit Glockengeläute auf die Weihnachtsmusik eingestimmt wurde. Mit einem Glöckchen wurden wir auch zur Bescherung gerufen.
Heiligabend
Ich bedaure es immer wieder, wenn dieser Tag so voller Hektik ist. Aber wie das so ist: ein Fest will vorbereitet werden. Ich freue mich aber schon darauf, am Abend einfach da zu sitzen und die Stille zu genießen.
Ilex
Ilex oder Stechpalme hat auch im Winter grüne Blätter und gerade jetzt so wunderbare rote Früchte und wird auch oft als Weihnachtsschmuck benutzt.
Jauchzen
Ich finde, das ist ein schönes Wort. "Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage..." Bei dem Wort hört man doch so richtig den kleinen Hüpfer, den Freudensprung!
Krippe
Das Zentrale von Weihnachten steht oft so am Rande. Bei meinen Großeltern gab es eine Krippenlandschaft, die einen großen Teil des Wohnzimmers beanspruchte. Da bekam man ein Gefühl dafür, daß da etwas Bedeutendes dargestellt wurde.
Lebkuchen
Lebkuchen sind ein typisches würziges Weihnachtsgebäck, das aber schon vier bis sechs Wochen vor Weihnachten gebacken werden muss. Beliebt sind vor allem die Hexenhäuschen aus Lebkuchen. Ich verschenke gerne Herzen und Sterne.
Mistelzweige
Nach einem englischen Brauch hängt man Mistelzweige über die Tür. Jeder, der hereinkommt, darf dann denjenigen küssen, der unter dem Zweig steht.
Nikolaus
Früher kam der Nikolaus immer selber, oder zumindest haben wir das geglaubt. Durch ein Gedicht konnten wir uns bei ihm beliebt machen und bekamen dann eine Tüte voller Nüsse, Äpfel, Gebäck und anderer guter Dinge. In weniger christlichen Familien wird der Nikolaus durch den Weihnachtsmann ersetzt, und der muß dann auch noch direkt das Christkind vertreten.
Orgelmusik
Das ist wie mit den Glocken: weil an Weihnachten viele Leute in die Kirche gehen, die sonst nicht gehen, und weil Orgeln nun mal meistens in Kirchen stehen, darum ist Orgelmusik in den Köpfen der Leute wohl mit Advent und Weihnachten verknüpft. Mir gefällt Orgelmusik aber auch sonst.
Plätzchen
Ich weiß nicht, was schöner ist: das Backen oder das Essen!
Quempas
Das alte Weihnachtslied berichtet von den Hirten, die das Kind in der Krippe lobpreisen: "Quem pastores laudavere". Die Abkürzung steht allgemein für weihnachtliches Singen.
Ruhe
Schön wär's! Wenn Du mal Zeit hast, fahr mal für ein halbes Stündchen in einen Wald, setz Dich hin und hör zu. Um diese Jahreszeit ist es da ganz schön still. Wieso machen wir in unseren Städten eigentlich so viel Hektik und Unruhe?
Sterne
Sie bringen eine Ahnung von Licht in die Nacht. Außerdem lassen sie von Unendlichkeit träumen. Sterne am Himmel haben etwas Geheimnisvolles. Sterne am Fenster bringen das Geheimnisvolle in die Wohnung.
Tannenbaum
Ich mag den Duft der Tanne und das Glitzern der Silberkugeln im Schein der Kerzen. Das Tannenbaumschmücken ist für mich eine der schönsten Vorbereitungen am Heiligabend.
U
Im Lexikon stehen sehr viele Wörter, die mit Un anfangen: Unfriede, Unruhe, Unlust. Das sind alles Negativ-Wörter, die man Weihnachten eigentlich vergessen möchte. Daß es so viele davon gibt, stimmt mich nachdenklich: wie ist unsere Welt denn wirklich? Und ist es das, weshalb wir uns mit der "weihnachtlichen Stimmung" so schwer tun?
Vorfreude
Früher haben wir uns auf die Geschenke zu Weihnachten gefreut. Ich bin mir ziemlich sicher, daß das früher das Aufregendste an der Adventszeit war. Auf was sind wir nun gespannt? Wie das Weihnachtsfest "abläuft", wissen wir eigentlich schon. Überwiegend ist es mit Streß verbunden, weil man so viel vorbereiten muß. Vielleicht klappt es deshalb nicht mehr so mit der Vorfreude?
Weihnachten
Nun, das ist es doch, worum es geht, oder?
Xylophon
Sooo viele Wörter gibt's ja nicht mit X! - Aber dieses Instrument fällt mir tatsächlich (gleich nach der Blockflöte) immer ein, wenn ich daran denke, daß wir - vor ewig langer Zeit - mit unserem Kindermusikkreis die Kinderweihnachtsgottesdienste gestaltet haben. Das war immer ziemlich aufregend. Natürlich wurden die Weihnachtslieder schon viel zu lange vorher geprobt. Aber schön war es dann doch, wenn "unsere" Kinder mit leuchtenden Augen musiziert haben. Und nach der Kinderchristmette, wenn der Druck der Verantwortung weg war, war für mich dann auch Weihnachten. Der Gottesdienst war wie ein Auftakt zum eigentlichen Fest.
Y
Dazu fällt mir nun wirklich nichts ein. Dir vielleicht?
Zimtsterne
Das ist ein Gebäck, das besonders intensiv nach Weihnachten duftet. Mmmmh!
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-11-11 14:34:38 mit dem Titel Adventsalphabet
Sind ja jetzt nur noch zwei Wochen bis dahin - und vielleicht findet der eine oder andere ja einen nette Anregung für die bevorstehende "stille Zeit".
Ich persönlich finde es immer schade,wenn der Advent in Hektik fast "untergeht", und deshalb versuche ich schon mal, mich darauf vorzubereiten. Vielleicht kann ich dann die Hektik etwas "entzerren".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-11-18 11:52:06 mit dem Titel Arbeitslosigkeit
Ich war auch mal arbeitslos.
Es ist nun schon mehr als 15 Jahre her.
Damals hatte ich nach einem pädagogischen Studium das Anerkennungsjahr gemacht und wurde nicht übernommen. Es war die Zeit der arbeitslosen Lehrer und Sozialpädagogen. Als Mathe- oder Physik-Lehrer hatte man ja noch die Aussicht, in der noch jungen Computerbranche unterzukommen. Aber ich?
Eine Familie war zu ernähren. Die Kinder waren noch klein. Keine einfache Situation war das damals.
Ziemlich ohne jede Hoffnung auf eine Lösung des Problems ging ich denn zum Arbeitsamt. Immerhin: ich galt zwar als schwer vermittelbar, aber doch eher zu der "gehobenen" Klasse bei den Arbeitslosen, da ich immerhin ein Studium hatte. Ich durfte in Hannover in den obersten Stock des Arbeitsamtes.
"Was können Sie denn sonst noch?" fragte mich der Vermittler mit mitleidigem Blick. Pädagogen liefen ja wirklich genug herum auf dem Flur.
"Na ja, in der Schule war ich mal ganz gut in Mathematik."
Das war ein Schlüsselwort! Mein Gegenüber strahlte. "Dann habe ich was für Sie!" Er gab mir eine Telefonnummer, eine Adresse und den Hinweis, daß dort am nächsten Morgen Vorstellungsgespräche seien.
Ich bin hingegangen. Wieviele Bewerber da saßen, weiß ich nicht mehr. Wir wurden alle zusammen in einen Raum gebeten, wo man uns einen Vortrag über die Firma und ihre Aufgaben hielt. Das klang ja alles sehr interessant - aber eben auch recht fremd. Aber was hatte ich schon für eine Wahl?
Ich muß vielleicht noch erklären, daß es damals ein Gesetz gab (das ist zwischendurch mehrmals geändert worden, was heute gilt, weiß ich nicht), nach dem man einen Anspruch auf eine Umschulung hatte, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hatte und 18 Monate gearbeitet hatte. Die Firmen bekamen für 18-Monats-Verträge Zuschüsse vom Staat, ähnlich wie bei ABM.
Nach dem Vortrag konnten wir noch Fragen stellen - aber ich bin fast sicher, daß niemand davon Gebrauch machte. Und dann wurden wir - falls wir noch Interesse hatten - noch zu Einzelgesprächen gebeten.
Ich habe von diesem Einzelgespräch nur in Erinnerung, daß ich gefragt wurde: "Trauen Sie sich die Arbeit bei uns zu?" - Nie vorher und nie hinterher in meinem Leben habe ich so geblufft wie in dem Moment, als ich meinem Gegenüber direkt in die Augen gesehen habe und mit fester Stimme "Ja" gesagt habe.
Ich bekam einen Vertrag.
18 Monate lang hat mir die Arbeit tatsächlich Spaß gemacht. Ich lernte schnell und viel und bekam auch Verantwortung. Mit Kollegen und Vorgesetzten kam ich prima klar. Der Verdienst stimmte auch einigermaßen. Wir konnten davon leben.
In der ganzen Zeit wurden immer wieder auch Leute aus diesen befristeten Verträgen übernommen. Das war natürlich auch meine Hoffnung: nicht wieder ins Ungewisse müssen, einfach dort weiterarbeiten können.
Leider ging es der Firma dann bald schlechter. Entlassungen standen an. Und obwohl meine Chefs sich aktiv für mich einsetzten, konnte ich in der Situation natürlich auch nicht übernommen werden.
Es blieb mir nichts anderes übrig: ich mußte wieder zum Arbeitsamt.
Da man als angelernte Kraft natürlich wenig Chancen hatte, war klar, daß ich die Chance auf eine Umschulung nutzen wollte. Es sollte was mit Computern sein, weil ich inzwischen gemerkt hatte, daß ich das auch konnte.
Über verschiedene Lehrgänge habe ich mich informiert. Allerdings gab es auch damals beim Arbeitsamt nur spärliche Informationen. Die Gespräche mit anderen Betroffenen brachten mehr. Ich entschied mich für eine zweijährige Berufsfachschule mit einer technischen Ausrichtung.
Und mit dieser festen Vorstellung kam ich zum Berater beim Arbeitsamt. Inzwischen war natürlich nicht mehr der nette Herr für mich zuständig, dem ich noch heute zutiefst für die erste Vermittlung dankbar bin.
Der neue Berater sah mich an, sah, daß ich eine Frau war, blickte auf meinen Lebenslauf und meinte: "Das können Sie doch gar nicht." Er wollte mich statt in die technische Richtung lieber in die wirtschaftswissenschaftliche drängen. Zu meinem Glück ließ ich mich nicht beirren.
Ich bestand die Aufnahmeprüfung im Vorübergehen. Die zwei Jahre gingen um wie nichts, und ich machte den Abschluß als Lehrgangsbeste. Das Zeugnis hätte ich gerne diesem dummen Berater vom Arbeitsamt gezeigt, der mir den Lehrgang nicht zugetraut hatte - aber ich hatte mir leider seinen Namen nicht gemerkt.
Nach dieser Ausbildung, die nun schon 13 Jahre her ist, bekam ich einen guten Arbeitsplatz. Auch wenn ich manchmal lieber etwas ganz anderes machen würde (Computer finde ich einfach schrecklich langweilig): um einen Arbeitsplatz brauche ich mir wohl keine Sorgen mehr zu machen.
Was will ich nun damit sagen:
Erst mal möchte ich allen Mut machen, die auf Arbeitssuche sind: auch wenn die Lage manchmal ziemlich aussichtslos scheint: gebt nicht auf. Meine Voraussetzungen waren auch nicht gerade gut.
Macht Euch selber ein klares Bild davon, was Ihr wollt. Mit nur vagen Vorstellungen konnte man auch vor 15 Jahren nicht besonders weit kommen. Ich bin noch immer froh, daß ich mich nicht von meinem Umschulungswunsch habe abbringen lassen.
Ich denke auch, daß eine Menge Eigeninitiative erforderlich ist. Und man muß sich über alles selber informieren. Nur mit Glück trifft man wohl auf Vermittler und Berater, die auch mal eine ungewöhnliche Frage stellen ("was können Sie sonst noch") und von Klischees abweichen.
Eine gute - und ich meine eine wirklich gute und anerkannte - Ausbildung scheint eine wichtige Voraussetzung zu sein, wenn sie auch kein Garant ist. Auch bei Lehrgängen, die vom Arbeitsamt gefördert werden, gibt es leider qualitativ große Unterschiede. Zu viele schöpfen nur die Fördergelder ab. Das ist auch der Eindruck bei dem, was ich in der letzten Zeit beobachten konnte.
Ich war vor knapp zwei Jahren auch mal mit meinem Sohn beim Arbeitsamt. Seine Voraussetzugen mit der verpatzten Schule waren wirklich so schlecht, wie es nur eben ging. Ich habe aber gemerkt: wenn man mit Selbstbewußtsein und klaren Vorstellungen und Zielen da hingeht, und wenn man hartnäckig darauf beharrt, dann bekommt man auch Unterstützung.
Notfalls hilft echt nur eins: allen Mut zusammennehmen und bluffen! Ja sagen - mit fester Stimme, auch wenn man ganz tief drinnen Nein denkt. Ja sagen, und dann aber auch selber Ja glauben.
"Ja, ich kann das! Ich traue mir das zu." Das scheint immer noch ein Schlüssel-Satz zu sein. weiterlesen schließenKommentare & Bewertungen
-
-
"A" wie Angst vor dem was danach kommt!

13.11.2002, 14:54 Uhr von
cityofbuffy
Ich lese gern und dekoriere gern unsere Wohnung, ob mit Windowcolor, Decoupage oder anderem Dekom...Pro:
keins
Kontra:
geistige und körperliche Schäden des Babys
Empfehlung:
Nein
Liebe Yopianer,
ich weiss nicht ob es jede schwangere Frau so empfindet. Einzelne Ängste was kommt eigentlich danach. Wie bekomme ich das während der Geburt alles hin. Wie bemerke ich das es richtige Wehen sind? Wie lange wird die Geburt dauern? Verläuft auch alles gut? Geht es meinem Baby auch gut?
Und das traurigste bei meinem Baby ist, das es sein kann das den "Graune Star" von seinem Papa geerbt haben kann. Nur da steht die Chance 50% zu 50% das es unser kleiner Schatz nicht bekommt. Davor habe ich besonders Angst. So müsste unser Engel mit gerade einmal 3 Lebensmonaten operiert werden. Sie würden dann die getrübte Linse im Auge, die durch den Grauen Star kommt, durch eine klare ersetzen. Und dann was kommt danach, bin ich eine gute Mama? Schaffe ich es Baby und Haushalt irgendwann einmal unter einen Hut zu bringen? Was ist wenn mein Freund arbeiten muss und ich gleich nachdem ich aus der Klinik komme ganz auf mich allein gestellt bin? Das sind Fragen die man sich oft in der Schwangerschaft stellt. Doch ich kann sie einfach nicht beantworten.
Ok, ich denke schon das ich eine gute Mama werde. Ich konnte mir ja durch meine eigenen Kindheit viel bei meiner eigenen Mama abschauen. Doch da sah es alles so einfach aus, obwohl es ja gar nicht so ist. Nachts aufstehen und stillen. Kaum schlafen können. Früh aus dem Bett und ran an die Arbeit, Windeln wechseln, Baby anziehen, pflegen und die dringendste Frage, wird es ständig schreien? Vielleicht habe ich ja gar keine Zeit mehr mich um den Haushalt zu kümmern. Naja, wozu hat man einen Freund mit dem man schliesslich zusammen wohnt. Und in dem Moment, wenn man daran denkt sind diese Sorgen schon wieder vergessen. Genauso, wird die Geburt sehr lange dauern und schmerzhaft sein? Es kann, aber es muss nicht. Und danach sind diese Schmerzen und die Zeit sowieso vergessen, da man ein kleines Geschenk in den Armen hält. Ein kleines Baby, was nur durch meinen Freund und mich entstanden ist. Wir wollten es und lieben es schon jetzt.
Die nächste Frage, was ist wenn mein Freund nicht da ist, wenn ich aus der Klinik komme? Das ist doch ein relativ kleines Problem, ich könnte meine Mama fragen ob sie mir hilft ein wenig im Haushalt in Ordnung zu bringen. Und schon wieder ist eine schwerwiegende Frage beantwortet.
Doch eine Frage kann man nie beantworten, bevor das kleine Baby auf der Welt ist. Welchen Charakter hat das Kind, wie lange schläft es, will es ständig etwas zu essen und ist es sehr anstrengend sich um dieses Mäuschen zu kümmern. Aber das habe ich und mein Freund so gewollt. Und auf der andere Seite freue ich mich auf die neue Verantwortung, auch wenn es auf jeden Fall nicht leicht ist ein Kind groß zu ziehen ist es eine regelrechte Zielsetzung. Man kann das Ziel erreichen, sein Baby zu einem guten Erwachsenen großzuziehen.
Fazit
Mittlerweile habe ich schon keine Angst mehr vor dem was mich nach der Geburt meines Babys erwartet. Ich konnte mir ja bei euch alles von der Seele schreiben. Ich freue mich wenn ihr euch meinen Bericht durchlest. Und ich hoffe ich erreiche das Ziel, das es den anderen schwangeren Frauen hilft das sie nicht allein mit solchen Fragen sind und durch das Schreiben und darüber Reden macht man sich auch wieder weniger Gedanken. Und man überlegt sich danach, über was man sich eigentlich die ganze Zeit den Kopf zerbrochen hat. Über Sachen, die man auch in den Griff bekommen wird, auch wenn es schwer wird.
Man kann alles schaffen, was man nur will.
Ciao sagt Marika und das voraussichtliche Mädchen Baby Cassandra :o)
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-11-13 13:54:18 mit dem Titel Alkohol während der Schwangerschaft
Liebe Yopianer,
das Thema Alkohol in der Schwangerschaft werde ich nie begreifen. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit keinen Tropfen Alkohol in der Schwangerschaft anzurühren. Muss das denn wirklich sein. Jeder weiss das dies dem Ungeborenen Kind schadet, ob es nun körperlich oder geistig ist.
Da ich selbst kurz vor der Entbindung stehe, weiss ich wovon ich spreche. Ich bin zwar keine Frau, die oft Alkohol trinkt, aber zu Feierlichkeiten trank ich doch immer einmal, vor der Schwangerschaft ein Glas Wein. Doch, als mein Freund und ich beschlossen uns ein Baby zu bekommen trank ich gar nichts mehr. Ein einziges mal nippte ich ein wenig an einem Glas Sekt, da Freunde mit uns auf unser Baby anstiessen, aber dieser "Schluck", der nicht einmal einer war brachte mich auch gleich zum Nachdenken. Wieso hast du das getan, die ganzen Giftstoffe gehen in das Blut des Babys und können nicht abgestossen werden?! Ich machte mir regelrechte Vorwürfe. Doch mein Frauenarzt sagte mir auch ein kleines Schlückchen macht überhaupt nichts aus.
Schäden bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft Alkohol tranken:
Die Organe und Zellen des Kindes werden beschädigt.
Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft Alkohol zu sich nahmen haben oft geistig eine Schwäche und schneiden schlechter in Intelligenztests ab. Sie haben überhaupt eine allgemeine Lernschwäche und sind nervös, zappelig und somit sind sie weniger aufmerksam.
Andere haben gleich bei der Geburt einen zu kleinen Kopf und dies ist ein Zeichen für eine geistige Entwicklungsschwäche. Viele dieser Kinder sind auch zu klein, wiegen zu wenig und haben Herzfehler.
Bei Alkoholabhängigen Frauen finde ich es sowieso verantwortungslos, das diese nicht oder falsch verhüten schwanger zu werden. Diese Kinder kommen mit Entzugserscheinungen auf die Welt und zittern. Sie sind von Anfang an ihres Lebens bestraft, sie dürfen nie in ihrem ganzen Leben einen Tropfen Alkohol anrühren, da dies zu einem Rückfall kommen wird. Und diesen hat die alkoholabhängige Mutter zu verantworten. Wenn man selbst mit seinem Leben nicht zurechtkommt sollte man doch nicht ein kleines Baby in dieses Leben zwängen. Welches nichts gegen sein Schicksal machen kann, da es sich nicht raussuchen kann auf die Welt zu kommen.
Fazit
Ich selbst habe dieses Problem Gott sei dank nicht, da ich verzichten kann, für mein Kind. Wer für sein eigen Fleisch und Blut nicht einmal auf seinen eigenen "Spaß" verzichten kann, der hat keine Chance für ein Baby Verantwortung zu tragen. Jeder weiss das Alkohol einem Ungeborenen schadet, wieso kann sich dann eine werdende Mutter nicht zurückhalten und nichts alkoholisches trinken. Ich habe selbst Bilder gesehen auf denen Kinder von Frauen gezeigt wurden, die während der Schwangerschaft getrunken haben. Es ist ein grausamer Anblick, es zog mir das Herz zusammen, als ich diese kleinen Babys sah. Man sah ihnen den Schmerz an und dann überlegt man ob die Mutter dieses Kindes, es überhaupt jemals geliebt hat, wenn es ihm soetwas antun kann.
Ciao sagen Marika und Baby Cassandra (38.SSW+2Tage) weiterlesen schließen -
abele Optik- preiswert, zuverlässig und schnell!

11.11.2002, 12:20 Uhr von
Leena
Es war einmal ein kleines Mädchen, das es sehr gerne hatte, wenn ihr jemand spannende, lehrreiche...Pro:
Service, Preis, Beratung, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit!
Kontra:
da gibts nix!
Empfehlung:
Nein
Vor Kurzem erst habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich z.B. in der Uni sitze, Schwierigkeiten habe das zu Lesen, was vorne auf der Folie gezeigt wird! Entweder ich musste die Augen zusammenkneifen und mich unheimlich anstrengen die Schrift zu entziffern, oder ich musste meinen Nachbarn fragen oder bei ihm abschreiben!
Naja, so auf Zeit ist das ja keine Lösung dachte ich mir und fasste kurzerhand noch in der Vorlesung den Entschluss gleich anschliessend zum Optiker zu gehen und einen Sehtest zu machen!
Gesagt, getan!
Eigentlich war es eher Zufall, dass ich letztendlich bei abele Optik landete, aber ich bin, auch wenn ich bisher Null Erfalrung mit Brillen, Sehtests, Optikern oder Ähnlichem hatte, wirklich sehr zufrieden!
Ich hatte keinen Termin ausgemacht, wurde aber dennoch total freundlich empfangen, ohne auch vorher gewartet zu haben! Die nette Dame, die dort wohl für alles mögliche zuständig war, führte mich dann auch gleich in ein separates Zimmer, in dem Apparaturen aufgebaut waren, wie man sie immer beim Augenarzt immer sieht!
Ich setzte mich also auf einen Stuhl, der in einiger Entfernung von einer Leinwand aufgestellt war, auf die dann Buchstaben, Figuren und Ähnliches projiziert wurden, die ich erkennen und nennen sollte!
Naja, am Anfang fiel mir das gar nicht so schwer, aber die Buchstaben wurden immer kleiner und kleiner und irgendwann sah ich nur noch verschwommen!
Die nette Dame von abele Optik machte dann noch einige Tests, die ich hier nicht weiter erläutern kann und will un d sagte mir dann anschliessend, dass ich eine Sehschwäche, Kurzsichtigkeit hätte, die zwar nicht so gravierend wäre, es aber dennoch sinnvoll sei, z.B zum Autofahren eine Brille zu verwenden!
Ich willigte dann sofort ein und ging mit ihr wieder in den Laden, um mir einige Modelle zeigen zu lassen!
Nachdem mir die Angestellte wirklich unzählige Modelle geduldig gezeigt hatte, ich mich aber immernoch nicht entscheiden konnte, weil ich unsicher war, bot sie mir an, mich mit den verchiedenen Brillen mit einer Kamera aufzunehmen und die Bilder dann anschliessend nebeneinander zu legen, damit ich mir ein objekiveres Bild machen könne!
Ich fand die Idee super und so nahm sie mich dann auf!
Um die Sache etwas abzukürzen: ich hab mich dann irgendwann für ein Brillengestell entschieden, was zudem noch relativ günstig war, da es sich um eine Hausmarke von abele Optik handelte!
ich wurde wirklich total nett empfangen und auch sehr gut beraten!
Die Angestellte hat sich richtig viel Zeit für mich genommen und mich auch sehr gut beraten, sodass ich mit einem guten Gefühl wieder gegangen bin!
Man hat mir sogar angeboten mehrere Brillenmodelle zur Ansicht übers Wochenende einfach mitzunehmen!
Unentgeltlich!
Nachdem alles veranlasst war, konnte ich die fertige Brille mit den passend eingesetzen Gläsern 2 Tage später schon abholen!
Abele Optik hat mich dann sogar angerufen und mir Bescheid gesagt, dass alles nun fertig sei!
Das nenn ich mal wirklich Service!!!
Mein Fazit:
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ebenso, wie der excellente Service und die tolle Beratung!
Ich hab mich wirklich wohl und gut beraten dort gefühlt und würde abele Optik wirklich ohne jegliche Bedenken weiterempfehlen!
In diesem Sinne -
eure wieder klar sehende Leena* weiterlesen schließen -
Aids

10.11.2002, 20:07 Uhr von
annika100
Hallo ihr süßen! Ich bin Annika, 19 Jahre alt und wohne in Salzgitter. Meine Hobbies bestehen zum...Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Nein
Immer mehr Menschen erkranken an Aids, obwohl jeder weiß, wie man es bekommen kann,wie böse es ist und wie man sich davor schützen kann.
Ich finde, das man sich mal richtig mit diesen Thema auseinander setzen sollte, ich ahbe dies getan, in der Schule und auch Privat.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends sterben mehr Menschen an Aids als jemals zuvor: Drei Millionen allein in diesem Jahr. Auch wenn hierzulande die Zahl der HIV-Neuinfektionen zurückgeht - Entwarnung bedeutet das noch lange nicht. Weltweit ist die Seuche noch immer auf dem Vormarsch, in Afrika könnte das tödliche Virus sogar eine ganze Generation vernichten.
Trotz aller Anstrengungen der Aidsforschung gibt es noch immer kein Heilmittel für die tödliche Seuche. Wer sich mit dem HI-Virus infiziert - und dies sind auch in Deutschland rund 2.00 Menschen pro Jahr - kann die Symptome bekämpfen und die Krankheit am Ausbrechen hindern. Das Virus völlig aus dem Körper vertreiben kann er jedoch nicht. Noch nicht.
Wie ist der Stand der Aids-Forschung im Jahr 2000 - knapp 20 Jahre nach dem Auftreten der Epidemie? Wird es in absehbarer Zeit ein Mittel geben, dass effektiv und vor allem billig genug ist, um auch die Millionen von HIV-Infizierten in Afrika vor dem Tod durch Aids zu retten? Wird es einen Impfstoff geben, der Menschen weltweit vor der Infektion mit dem tödlichen Virus schützt?
Positiv ist nicht gleich Krank
Die Stadien einer HIV-Infektion
Eine HIV-Infektion ist nicht gleichbedeutend mit Aids. Zwar ist das HI-Virus der Erreger der Krankheit, doch zwischen der HIV-Infektion und dem Ausbruch von Aids vergehen oft Jahre. Wenn geeignete Medikamente unternommen werden, kann es sogar sein, dass die Krankheit überhaupt nicht ausbricht. Doch was geschieht im Körper, wenn man sich infiziert? Wie läuft eine Infektion ab? Was sind die Symptome?
HIV-Positiv
Rund 45 Tage bis maximal sechs Monate nach der Infektion hat die Immunabwehr so viele Antikörper gegen das Virus gebildet, dass sie in einem der gängigen HIV-Tests nachgewiesen werden können.
Asymptomatische HIV-Infektion.
In diesem Stadium, das Monate oder auch Jahre anhalten kann, hinterlässt die Infektion keine speziellen Symptome. Die Lymphknoten können zwar leicht geschwollen sein, aber im großen und Ganzen ist der Infizierte in seiner Fitness nicht besonders beeinträchtigt. Trotzdem kann die Anzahl der T-Helferzellen schon abgesunken sein, denn das Virus legt nach der Infektion in der Regel keine Ruhephase ein, sondern vermehrt sich die ganze Zeit über.
Symptomatische HIV-Infektion/Aids
Studien haben gezeigt, dass mit steigender Dauer der HIV-Infektion auch die Wahrscheinlichkeit zunimmt, deutliche Krankheitssymptome zu entwickeln. Wann die Krankheit jedoch beim Einzelnen ausbricht, ist von einer ganzen Reihe von Cofaktoren abhängig. Zu den begünstigenden Faktoren zählen höheres Alter, Infektion durch heterosexuelle Kontakte, schlechte Ernährung und Immunschwäche, Stress, und vermutlich auch genetische Faktoren.
Die Symptome beim Ausbruch der Krankheit stammen meist von sekundären Infektionen, die sich wegen des durch den HI-Virus geschwächten Immunsystems ungehemmt ausbreiten können. Zu diesen opportunistischen Infektionen gehören typischerweise Pilzinfektionen, Lungenentzündungen oder Tumore. Zwar kann auch der Aidserreger selbst Symptome verursachen, darunter der langsame Gewichtsverlust und in einigen Fällen Gedächtnisstörungen, aber die große Mehrheit der Aids-Symptome stammt nicht vom Virus sondern von anderen Erregern.
Was geschieht bei einer Infektion?
Kleines ABC der Abwehrzellen
Gegen Eindringlinge von außen ist der menschliche Körper mit einem Heer von unterschiedlich spezialisierten Abwehrzellen ausgestattet. Über Botenstoffe und das Lymphsystem kommunizieren sie und koordinieren so die Abwehrstrategie des Körpers.
Makrophagen
Die ersten Abwehrzellen, mit denen ein eingedrungener Fremdkörper in Berührung kommt, sind meist die Makrophagen. Diese "Fresszellen" des Immunsystems sind in fast allen Geweben des Körpers präsent und zirkulieren zusätzlich auch im Blut. Sie verschlingen als fremd erkannte Mikroorganismen und andere Antigene und verdauen sie. Außerdem produzieren sie verschiedene starke Wirkstoffe, die andere wichtige Reparatur- und Abwehrzellen anlocken.
Neben ihrer Funktion als unspezifische "Gesundheitspolizei" und allgemeines "Aufräumkommando" spielen sie für die Einleitung einer spezifischen Immunreaktion eine entscheidende Rolle: Sie transportieren aufgenommene Antigene zu den Lymphknoten und präsentieren sie dort den Lymphozyten, den Zellen, die die Produktion von Antikörpern einleiten und steuern.
Lymphozyten
Die wichtigsten "Agenten" der Immunabwehr des Körpers sind die Lymphozyten, eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Ein erwachsener Mensch hat knapp über tausend unterschiedliche lymphatische Zellen, sie machen zwei Prozent des Körpergewichts aus. Für die spezifische Abwehr gegen HIV und andere Viren sind vor allem drei Typen von Lymphozyten entscheidend: die T-Helferzellen, T-Killerzellen und B-Lymphozyten.
B-Lymphozyten
Die Vorläuferzellen aller Lymphozyten bilden sich, wie alle Blutzellen im Knochenmark und wandern dann an ihre jeweiligen Einsatzorte. Ein Teil von ihnen reift jedoch noch im Knochenmark zu den sogenannten B-Zellen - abgeleitet von "bone marrow" dem englischen Begriff für Knochenmark - heran. Ihre Aufgabe ist es, jeweils auf einen Fremdkörper zu reagieren und die Produktion von spezifischen Antikörpern gegen den Eindringling auszulösen. Damit das Immunsystem bei einem erneuten Kontakt mit dem Fremdkörper vorbereitet ist, "merkt" sich ein Teil der B-Zellen, die sogenannten Gedächtniszellen, den Fremdstoff, und kann daher beim nächsten Mal direkt mit der Produktion der passenden Antikörper beginnen. Diese "sekundäre Immunantwort" liegt auch den meisten Schutzimpfungen zugrunde.
T-Zellen
Wichtigste Eigenschaft der Lymphozyten ist ihre Fähigkeit, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip mit einer bestimmten Molekülform zu reagieren. Sie tragen auf ihrer Oberfläche Rezeptoren - das "Schloss" - die speziell an die Struktur eines von Millionen von verschiedenen Fremdkörpern angepasst sind - den "Schlüssel". Für die Entwicklung neuer "Schlösser" sind die T-Zellen verantwortlich.
Ihre Vorläuferzellen entstehen, wie die B-Zellen im Knochenmark, sie wandern jedoch schon früh in die unter dem Brustbein gelegene Thymusdrüse aus und werden dort darauf geeicht, zwischen "fremd" und "körpereigen" zu unterscheiden.
Präsentiert ihnen eine Fresszelle einen "Eindringling", erkennen sie ihn anhand der komplizierten Struktur aus zelleigenem und -fremdem Protein auf der Oberfläche der Makrophagen als "neu und fremd" und setzen die spezifische Immunabwehr in Gang. Sie beginnen sich zu vermehren und differenzieren sich dabei in zwei Zelltypen aus:
Die T-Helferzellen tragen auf ihrer Oberfläche einen speziellen Rezeptor, das CD4, der bei der HIV-Infektion eine Schlüsselrolle spielt, da er einer der Einfallstores für das Virus bei der Zerstörung der T-Helferzellen ist. Bei der Immunantwort schütten die T-Helferzellen bestimmte Substanzen aus, die Cytokine, die die antikörperproduzierenden B-Zellen zu schnellerem Wachstum anregen und sie aktivieren.
Die zweite T-Zellsorte sind die T-Killerzellen, auch CD8+ Zellen genannt. Sie können sich gezielt mit dem Fremdkörper verbinden und ihn zerstören. Bei einer HIV-Infektion erkennen sie die vom Virus befallenen Zellen an einem speziellen Marker auf der Zelloberfläche und zerstören sie. Fatalerweise befällt das HI-Virus bei einer Infektion nicht nur die "normalen" Körperzellen, sondern, und dies macht die Krankheit so schwer bekämpfbar, auch die entscheidenden Zellen des Immunsystems, die T-Helferzellen und die Killerzellen. Damit schaltet es effektiv die wichtigsten Abwehrwaffen des Körpers aus und kann sich erfolgreich vermehren...
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-11-10 19:02:10 mit dem Titel Schnupfen oder Allergie?
Ich selber habe auch Allergien.
Ich bin allergisch auf Katzen, aber davon merke ich nichts,
Hausstaub dagegen mehr, ich habe das ganze Jahr über so etwas wie einen leichten Schnupfen, der kommt und geht, wie er es will.
Und was bei mir das allerschlimmste ist, ich habe eine Schokoladenallergie.
Die macht sich dadurch bemerkbar, wenn ich Schokolade esse, dann kommen innerhalb von ca. einer Stund tausende von Pickeln in mein Gesicht und die jucken und tun weh.
Hier ein paar Texte, die vielleicht ganz nützlich sind.
***********************************************************************
Schnupfen oder Allergie?
Einige typische Allergie- Symptome
Woran erkennt man, ob der lästige Schnupfen eine Infektion oder ein Heuschnupfen ist? Kann Kopfweh ein Allergiesymptom sein? Endgültigen Aufschluß darüber, ob es sich um eine Allergie handelt oder nicht, kann natürlich nur ein Besuch beim Arzt und ein Allergietest geben, dennoch kann ein Zusammentreffen von mehreren der im Folgenden beschriebenen Symtome schon ein erstes Warnzeichen sein.
Gerötete, tränende und geschwollene Augen in Kombination mit laufender oder verstopfter Nase und häufiger Niesreiz ohne daß Fieber, Gliederschmerzen oder andere eindeutige Erkältungssymptome dazukommen. Wichtig ist es auch, darauf zu achten, wann die Beschwerden am schlimmsten sind: Typisch für eine Hausstauballergie ist beispielsweise die Verschlimmerung der Symptome im Bett und morgens nach dem Aufstehen, Heuschnupfen verschlechtert sich eher draußen oder gegen Abend.
Dauert der „Schnupfen" länger als einige Wochen, ist in jedem Falle ein Arztbesuch ratsam, ebenso bei häufigem Husten oder Atemnot ohne begleitende Erkältungssymptome.
Treten nach dem Essen bestimmter Lebensmittel regelmäßig Übelkeit oder Verdauungsprobleme auf, liegt vielleicht eine Unverträglichkeit vor. Kopfschmerzen nach dem Genuß von Kaffee oder Schokolade können ebenfalls allergischen Ursprungs sein.
Rötungen, Entzündungen und nässende oder juckende Hautausschläge müssen zwar nicht, können aber durch eine allergische Reaktion auf bestimmte Substanzen entstehen.
Gerade wenn Eltern oder Großeltern bereits unter Allergien leiden, sollten Symptome dieser oder ähnlicher Art ein Grund sein, doch mal zum Arzt zu gehen und vielleicht einen Allergietest machen zu lassen.
***********************************************************************
Was ist eine Allergie?
Eine Allergie ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems gegenüber bestimmten körperfremden Substanzen der Umwelt. "Überschießend" heißt die Reaktion, weil das körpereigene Immunsystem auf Fremdstoffe (z.B. Pollen) anspricht, die anders als Krankheitskeime eigentlich keine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Prinzipiell kann jeder Stoff in unserer Umwelt zum Auslöser einer Allergie werden - vom Apfel bis zur Zwiebel, vom Angorafell bis zur Zahnpasta. Für 20.000 Substanzen ist nach vorsichtigen Schätzungen eine allergieauslösende Wirkung bekannt.
Bei den meisten Allergenen handelt es sich um Eiweißsubstanzen tierischer oder pflanzlicher Herkunft, beispielsweise von Blütenpollen, Milben und Schimmelpilzen.
Allergische Symptome . .
. . am Auge:Bindehautentzündung, Lidschwellung
. . in den Atemwegen: Heuschnupfen (saisonaler Schnupfen), Dauerschnupfen, Schwellungen der Atemwege, Asthmatische Beschwerden
. . an der Haut: Nesselsucht (Urtikaria), Angioödem / Quincke-Ödem, Ekzeme, Neurodermitis
. . im Magen-Darm-Trakt: Übelkeit, Durchfall, Magenschleimhautentzündung
. . allgemeine Reaktionen: generalisierter Juckreiz, Gelenkschmerzen (rheumatische Beschwerden), Fieber, Migräne, Depression / anhaltende Müdigkeit, Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock).
Allergiediagnostik
Bei der Diagnostik allergischer Erkrankungen besteht das spezielle Problem, dass den Krankheitsbeschwerden - wie etwa Schnupfen, Asthma, Ekzeme, Magen-Darm-Beschwerden oder Migräne - eine Unmenge allergieauslösender Substanzen gegenüberstehen. Um aus den mindestens 20.000 bisher wissenschaftlich bekannten Allergenen das für den Patienten Zutreffende herauszufinden, bedarf es "detektivischer Fähigkeiten" und aufwendiger Diagnosemethoden. Die Allergiediagnostik verläuft in der Regel nach folgenden vier Stufen:
1. Anamnese
Aus der Erhebung der allergologischen Krankheitsvorgeschichte können bereits wertvolle Hinweise auf den möglichen Allergieauslöser gewonnen werden. Zusätzlich sollen die häusliche und berufliche Umwelt, die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten sowie die zumindest orientierende Erfassung des psychosozialen Umfeldes berücksichtigt werden. In besonderer Weise sind selbstbeobachtete Beziehungen zwischen den allergischen Symptomen und möglichen Allergenen sowie die Umgebungsbedingungen privater und beruflicher Art festzuhalten. Besonders wichtig sind die Erfassung des Krankheitsbeginns (auch möglicher "Vorboten") und die Hinweise auf den primären Allergenkontakt.
2. Hauttests
Hauttests (Prick-Test, Intrakutantest, Scratch-Test und Reibtest) sind das Fundament der Allergendiagnostik. Hier werden Proben verschiedener Substanzen (mögliche Allergene) auf die Haut aufgebracht und beobachtet, ob eine allergische Reaktion an dieser Hautstelle (als Pustel oder Quaddel) auftritt. Je nach diagnostischer Zielsetzung kann sich der Arzt beschränken und durch Einzelproben die laut vorhergehender Befragung verdächtigen Allergene prüfen ("Bestätigungstest"). In den meisten Fällen jedoch handelt es sich um eine Suchdiagnostik, bei der es darauf ankommt, durch Gruppenextrakte in einer einzigen Sitzung ein möglichst breites Allergenspektrum zu erfassen. Hauttests führen zu falschen Ergebnissen, wenn gleichzeitig Antihistaminika oder Kortikosteroide eingenommen werden. Daher sollten schon 5 Tage vor einem beabsichtigten Hauttest Antihistaminika gemieden werden.
Prick-Test: Auf dem Arm wird ein Tropfen mit der Testlösung aufgetragen und dann die Haut an dieser Stelle mit der Prick-Lanzette ca. 1 mm tief durchstochen. Im Falle einer bestehenden Allergie gegen die Testsubstanz hat sich nach ca. 20 min dann an dieser Stelle eine Quaddel gebildet. Bei Allergien des Soforttyps wird der Prick-Test als Standardmethode angewandt.
Intrakutantest: Der Intrakutantest ist etwa 10.000mal empfindlicher als der Prick-Test, ergibt aber häufiger falsch positive Ergebnisse, vor allem bei Nahrungsmittelallergenen. Hierbei wird das Allergen mit einer Nadel in die Haut gespritzt.
Scratch-Test: Durch die aufgetragenen Testlösung wird die Haut oberflächlich angeritzt. Wegen des relativ großen Hautreizung ist dieser Test nicht immer eindeutig. Daher hat der Scratch-Test heute an Bedeutung verloren.
Reibtest: Das Allergen bzw. das native/originale Testmaterial wird mehrfach auf der Innenseite des Unterarms hin- und hergerieben. Dieser Test wird dann eingesetzt, wenn eine hochgradige Sensibilisierung des Patienten besteht. Da dieser Test mit dem natürlichen Allergen durchgeführt wird, ist er auch geeignet, wenn die Allergieauslösende Substanz nicht in industriell vorgefertigter Ausführung erhältlich ist.
Epikutantest (Pflastertest): Pflaster mit allergenhaltiger Substanz werden auf die Haut (bevorzugt Rücken) geklebt und nach 24, 48 oder 72 Stunden abgelesen. Dieser Test dient zur Identifizierung von Typ-IV-Allergenen.
3. Labortests
Bluttests: Hier werden mit Hilfe von Blutproben die Reaktionsbereitschaft und spezifische Sensibilisierung gegen die untersuchten Allergene im Labor untersucht. Ein Kriterium ist das Vorhandensein spezifischer IgE-Antikörper.
4. Nachanamnese und Provokationstest
Die Deutung des Testergebnisses erfordert immer eine Überprüfung durch Erhebung einer "Nachanamnese" (Ist der Patient überhaupt dem Allergen ausgesetzt? Passen Symptome und Testergebnis zusammen?). Ob der durch positive Hauttests und/oder Bluttests ermittelte IgE-Antikörper einer aktuellen klinischen Wirksamkeit des jeweiligen Allergens entspricht, kann nur durch direkte Prüfung am betreffenden Organ mit Hilfe eines Provokationstests endgültig geklärt werden.
Provokationstest: Im Provokationstest wird das klinische Symptom (z.B. Bindehautentzündung mit Rötung und Augentränen, Asthma, Hautausschlag, Ekzem) reproduziert durch weitgehende Nachahmung der "natürlichen Bedingungen", z.B. bei einer Hausstaubmilbenallergie wird das Milbenallergen in die Atemwege geblasen.
Therapiemaßnahmen bei Allergien
1. Allergenkarenz
Das Meiden des Kontakts mit dem beschwerdeverursachenden Allergen (Allergenkarenz) ist die beste, sicherste Methode zur Therapie. Nahrungsmittel, auf die man allergisch reagiert, sollen nicht gegessen werden. Im Falle einer Nickelallergie wäre nickelhaltiger Schmuck (Modeschmuck, Weißgold) zu meiden. Eine Karenz ist jedoch nicht immer leicht durchzuführen. Insbesondere bei in der Luft vorhandenen Allergenen wie Pollen und Schimmelpilzen wird dies schwierig, weil diese Allergene mit der Luft oft über mehr als 100 km verbreitet werden. Ein Pollenallergiker müsste während der Blütezeit seines Pollens in Klimazonen verreisen, in denen die Blühzeiten zeitlich anders verlaufen oder die Pflanze, auf die er allergisch reagiert, am besten gar nicht vorkommt. Oft ist ein Aufenthalt im Hochgebirge oder an Küstenbereichen bzw. auf den Inseln günstig. Wenn solche Maßnahmen nicht möglich sind, um den Kontakt mit dem Allergen zu unterbinden, ist eine Hyposensibilisierung angezeigt.
2. Hyposensibilisierung
Die einzige ursächliche Therapie von Allergien ist die Hyposensibilisierung (sinngemäß: "unempfindlich machen"). Die Idee dieser Behandlung ist es, dem Allergiekranken das für ihn aktuelle Allergen allmählich in steigender Dosis zuzuführen, um ihn so dagegen unempfindlich zu machen. Die Behandlung wird mit aufgereinigtem Allergenextrakt durchgeführt. Im Laufe von meist zwei bis drei Jahren bekommt der Patient langsam steigende Dosen dieser Allergenlösungen gespritzt (klassische Hyposensibilisierung) oder alternativ in Tropfenform verabreicht (orale Hyposensibilisierung). Die Dosierung wird dabei stets derart gewählt, dass gerade noch keine allergische Reaktion ausgelöst wird. Eine Hyposensibilisierung sollte stets von einem allergologisch erfahrenen Arzt durchgeführt werden. Bei unfachmännischer Handhabung kann sie Nebenwirkungen aufweisen. Richtig angewandt hingegen ist die Hyposensibilisierung eine erfolgversprechende Therapie.
3. Medikamentöse Behandlung
Die medikamentöse Behandlung dient zur Linderung und Vermeidung der Krankheitssymptome und zur Behandlung der entzündlichen Schleimhautschwellungen. Sie bekämpft zwar nur die Symptome, nicht die Ursache, ist jedoch oft die einzige Möglichkeit, um den betroffenen Patienten, beschwerdefreie oder mit nur geringen Beschwerden belastete Tage zu verschaffen.
Antihistaminika
Im Verlauf der allergischen Reaktionen wird vermehrt Histamin freigesetzt, das als Botenstoff die allergischen Reaktionen des Körpers, wie Juckreiz, Schleimhautschwellung usw. veranlasst. Antihistaminika-Präparate wirken den Histamin-Effekten entgegen. Sie helfen dadurch gegen den Juckreiz und Hautausschlag, mindern Schwellungen und dämmen Niesattacken und Nasenfluss ein. Die beschwerdelindernden Wirkungen treten bereits nach wenigen Minuten ein. Präparate, die direkt lokal am Ort der Beschwerden (also Nase oder Augen) eingesetzt werden, verursachen fast keine Nebenwirkungen mehr.
Dinatriumcromoglycat (DNCG)
DNCG stabilisiert die Mastzellen und blockiert damit deren Histaminausschüttung. DNCG wirkt nicht bei akut auftretenden Beschwerden, sondern vorbeugend. Deshalb muss DNCG beispielsweise während der Pollensaison regelmäßig (täglich) angewendet werden, oder ca. eine Stunde vor dem Genuss einer Mahlzeit, die Nahrungsallergene enthalten könnte.
Kortison
Das Kortison, ein körpereigenes Hormon der Nebennierenrinde, wird eingesetzt, um bleibende Schäden als Folge der chronischen, allergisch verursachten Entzündung in ihrem Ausmaß zurückzuhalten. Bei inhalativen Allergien wird es überwiegend als Spray zur Inhalation oder als Nasenspray eingesetzt. Kortison schützt die Schleimhäute vor den Entzündungserscheinungen. Als Spray ist es nahezu frei von Nebenwirkungen, da es hier direkt an die Schleimhäute und nicht in den Blutkreislauf gelangt. Auch Kortison entfaltet seine Wirkung vorbeugend; es wirkt nicht im akuten Anfall. Bei Hautekzemen werden kortisonhaltige Hautcremes verwendet, um das Ekzem zum Abheilen zu bringen und einer chronischen Hautveränderung vorzubeugen.
***********************************************************************
Hier meine Allergien:
Hausstaubmilben-Allergie
Die Hausstauballergie wird vorwiegend durch die im Hausstaub lebenden Milben ausgelöst, wobei das eigentliche Allergen aus dem Kot der Milben stammt. Die Hausstaubmilben sind ganz natürliche Mitbewohner unserer häuslichen Umgebung und haben nichts mit Unsauberkeit zu tun. Sie übertragen auch keinerlei Krankheiten. Die Milben sind 0,1 bis 0,5 mm groß und daher mit bloßem Auge nicht zu sehen.
Eine Milbe produziert im Laufe ihres zwei bis vier Monate langen Lebens etwa das 200-fache ihres Gewichtes an Exkrementen. Die Kotbällchen, die zunächst noch von einer schleimartigen Schicht umgeben sind, zerfallen nach deren Austrocknen in sehr kleine Teilchen, die sich dann mit dem Hausstaub verbinden. Durch Bewegungen von Textilien, wie Bettdecke oder Matratze, Polstermöbeln und Teppichen, sowie durch den Luftzug z. B. im Rahmen des Staubsaugens, wird dieser allergenhaltige Staub aufgewirbelt und mit der Atemluft inhaliert. Dies führt vorwiegend zu allergischen Atemwegserkrankungen wie Augentränen oder -jucken, Fließschnupfen, Niesanfälle, und in schwerwiegenden Fällen tritt Husten, Atemnot und ein allergisches Asthma bronchiale auf.Treten diese heuschnupfenähnlichen Symptome das gesamte Jahr über auf, und sind die Beschwerden besonders nachts und am frühen Morgen nach dem Aufstehen stärker, so deutet dies auf eine Hausstaubmilben-Allergie hin.
Steckbrief der Hausstaubmilbe
Die zwei häufigsten Milbenarten in unserer alltäglichen Umgebung sind die Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae. Die Milben zählen zur Gruppe der Spinnentiere. Sie ernähren sich hauptsächlich von menschlichen und tierischen Hautschuppen und Schimmelpilzen. Täglich verliert der Mensch etwa ein bis zwei Gramm Hautschuppen, genug um davon 1,5 Millionen Hausstaubmilben einen Tag lang zu ernähren.
Zu ihrer Vermehrung und Allergenproduktion benötigen die Milben bestimmte ökologische Voraussetzungen. Neben der Sicherstellung der Nahrung durch menschliche Hautschuppen, Schimmelpilze etc. stellen vor allem Umgebungsfeuchtigkeit und Temperatur die wichtigsten Faktoren dar. Die optimalen Klimabedingungen für die meisten Milbenarten liegen bei einer mittleren relativen Feuchtigkeit von 70 Prozent und einer Temperatur von 25C.Die Hauptvermehrungszeit der Hausstaubmilben liegt in den Monaten Mai bis Oktober. Mit Beginn der Heizperiode und der damit verbundenen Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit stirbt der größte Teil der Milben ab. Damit hat sich nun die maximale Menge an Exkrementen angesammelt, so dass die Beschwerden für den Hausstaubmilben-Allergiker in dieser Zeit am größten sind. Im Hochgebirge, das heißt über 1.200 Meter, sind kaum Hausstaubmilben anzutreffen.
Lebensraum der Hausstaubmilbe
Das Hauptreservoir der Milben sind die Matratzen der Betten. Weitere Lebensräume bieten sich in textilen Polstermöbeln, Teppichen und Teppichböden. Die früher grundsätzlich gegebene Empfehlung bei Hausstaub- bzw. Milbensensibilisierung Teppiche zu entfernen, kann nach dem heutigen Stand der Forschung nicht mehr generell aufrecht erhalten werden. Auch die Anschaffung von Materialien, z.B. Matratzen aus Synthetik und der Verzicht auf organische Materialien hat sich als wenig wirksam erwiesen.
Heute stehen vielmehr verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Milbenwachstum und Allergenproduktion in Innenräumen zu vermindern. Die wichtigste Maßnahme ist, die Matratze des Bettes mit einem milbendichten Schutzbezug (Encasing) zu versehen. Damit wird den Milben ihr Hauptlebensraum abgesperrt und verhindert, dass das Milbenallergen durchdringen kann.
Tipps bei Hausstaubmilbenallergie
Wenn die Matratze älter als acht Jahre ist, sollte sie gegen eine neue ausgetauscht werden.
Matratzen mit speziellen milbendichten Überzügen (Encasings) versehen.
Oberbett, Kopfkissen und Bettwäsche sollten bei 95C waschbar sein, mindestens jedoch bei 60C. Alternativ können Oberbetten/Kopfkissen ebenfalls mit Encasings versehen werden.
Alle Räume stets gut lüften und trocken halten.
Teppiche und Teppichböden können halbjährlich mit sogenannten "akariziden Mitteln" (in der Apotheke erhältlich) gereinigt werden.
Polstermöbel müssen regelmäßig gesäubert werden und lassen sich ebenfalls mit akariziden Mitteln behandeln.
Vorsicht vor allem bei alten Polstermöbeln! Hier kann sich vielleicht im Laufe der Jahre eine ansehnliche Milbenpopulation gebildet haben.
Ledermöbel sind unproblematisch. Hier finden Milben keinen Lebensraum.
Bei der Wahl der Staubsauger sollte man auf Geräte mit speziellen Feinstaubfiltern achten. Die Filtertüten sollten nicht länger als 14 bis 21 Tage im Staubsauger bleiben.
Vor allem im Schlafbereich auf Staubfänger verzichten. Dazu gehören Velours, Vorhänge, offene Bücherregale u.a.
Kuscheltiere von Kindern können durch einen Besuch in der Kühltruhe von Milben befreit werden. Alternative sind (bei mind. 60C) waschbare Kuscheltiere.
Als Urlaubsgebiete empfehlen sich für Hausstauballergiker Regionen über 1.200 Meter Höhe.
* * * * * *
Nahrungsmittel-Allergie
Der Verzehr von Nahrungsmitteln bedeutet für fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung nicht nur Genuss. Eine Nahrungsmittel-Allergie zeigt sich beispielsweise mit Juckreiz und Schwellungen im Mund, mit Durchfall, Blähungen, Quaddeln, mit Ekzemen an Haut und Schleimhäuten, mit Husten und Atemnot. Eine Nahrungsmittelallergie kann häufig lange Zeit unentdeckt bleiben. Der Weg zu ihrer Enttarnung ist oft mit wahrer Detektivarbeit verbunden, bei der auch eine qualifizierte Ernährungsberatung nützlich sein kann.
Die Allergiediagnostik stützt sich auf vier Säulen:
Das Gespräch zur Krankengeschichte, die Anamnese, bei der erörtert wird, wann, wo und wie die Symptome erstmals und im weiteren Verlauf beobachtet wurden,
Hauttests oder Bluttests, bei welchen eine Sensibilisierung gegen einzelne Nahrungsmittel über spezielle Antikörper im Blut nachgewiesen wird.
Je nach Eindeutigkeit dieser Tests wird die klinische Diagnose mit (Weglass-) Diät und
Provokationstests durchgeführt.
Tipp zur Diagnose von Nahrungsmittel-Allergien
Führen Sie bei Verdacht auf Nahrungsmittel-Allergien ein Ernährungstagebuch und tragen Sie so genau wie möglich ein, wann Sie was gegessen haben und wann welche Symptome aufgetreten sind. Vergessen Sie dabei auch nicht Zwischenmahlzeiten, kleine Naschereien, Gewürze und gegebenenfalls Marken / Artikel, um Zusammensetzungen von Produkten nachfragen zu können.
Die erste Wahl im Umgang mit Nahrungsmittel-Allergien liegt in der Karenzkost, d.h. im Vermeiden der Lebensmittel bzw. Inhaltsstoffe, die Probleme auslösen. Wichtig ist jedoch, nicht einfach ein Nahrungsmittel wegzulassen, sondern eine ausgewogene Ernährung trotz Allergie zu gewährleisten.
Zu den häufigsten Nahrungsmittel-Allergenen gehören Milch, Hühnerei, Nüsse, Weizen, Obst (als Kreuzreaktion auf Pollen-Allergien) und Soja.
Milch-Allergie
Auslöser der allergischen Reaktionen ist das Protein der Milch, wobei bislang fünf verschiedene Eiweiß-Komponenten bekannt sind, von denen vor allem Casein und ß-Lactoglobulin als häufigste Auslöser gelten.Da nicht jeder Kuhmilch-Allergiker auf alle fünf Komponenten reagiert, wird teilweise gekochte Milch oder ein Sauermilchprodukt vertragen.
Zu der breiten Palette der Milchprodukte, die im Zweifelsfall gemieden werden müssen, gehören neben Trinkmilch, Joghurt, Sahne, Quark und ähnlichem auch Wurstwaren wie Brühwürste, Schinkenwurst, fertig paniertes Fleisch, Fleischkonserven, Heringsalat, Fertiggerichte, Brote, die Milch enthalten können, (wie Graham-, Toast- und Buttermilchbrot, Brötchen, Hefezopf), Waffeln, Kuchen, Pfannkuchen, Milchreis, Kartoffelfertigprodukte, Nougatcreme, Pudding, Eisspeisen, Schokolade, Karamellbonbons, fertige Saucen, Mayonnaise, Ketchup, Sahnelikör.
Milch wird zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, zum Beispiel als Bindemittel in Fertigprodukten, zur Aufwertung des Eiweißgehaltes in Fleischerzeugnissen, zur Verfeinerung von Feinkostsalaten, als Flüssigkeitszugabe in Kuchen, Brot und Gebäck. Wichtig ist es daher, das Zutatenverzeichnis genau zu lesen. Hinweise auf Milcheiweiß liefern Begriffe wie: Molkenprotein, Süßmolke, Sauermolke, Casein, Kaseinate.
Ersatz für Milch
Als Ersatz kommen teilweise Ziegen- und Schafkäse in Frage. Hier treten Kreuzreaktionen selten auf. Hingegen vertragen viele Kuhmilch-Allergiker keine Soja-Produkte.Bei Vermeidung aller Milchprodukte, muss die Ernährung um bestimmte Vitamine und Nährstoffquellen ergänzt werden.
Hierzu gehört vor allem Calcium. Calciumreiche Nahrungsmittel sind Gemüsesorten wie Broccoli, Grünkohl und Fenchel, Hülsenfrüchte, Gartenkräuter, wobei diese alleine kaum den ganzen Tagesbedarf decken. Calcium wird besser vom Körper verwertet, wenn ausreichend Vitamin D vorhanden ist. Vitamin D ist in Fisch enthalten, bildet sich jedoch auch bei Sonneneinstrahlung in der Haut.
Calciumreiche Mineralwasser sind ein wichtiger Calcium-Lieferant. Es gibt Sorten, mit bis zu 800mg Calcium pro Liter.
Hühnerei-Allergie
Reagiert wird nicht auf das ganze Ei, sondern auf bestimmte Inhaltstoffe, die Proteine bzw. das Eiweiß. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man das Eigelb verträgt. Eiweiß ist hier vielmehr der Oberbegriff für eine Nährstoffgruppe. Die Allergie-Auslöser des Eies - wie zum Beispiel das Ovalbumin - werden teilweise durch das Erhitzen zerstört. Da andere Eiweiß-Fraktionen jedoch hitzestabil sind, muss Ei in jeder Form gemieden werden.Hierzu gehören nicht nur Eierspeisen, sondern auch Produkte wie Panaden, Cremespeisen, Mayonnaise et cetera.
Durch ihre vielseitigen Eigenschaften werden Eier in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. So etwa
- als Bindemittel in Teig- und Backwaren, Panaden, Mehl- und Kartoffelklößen,
- als Emulgator in Saucen, Cremespeisen, Mayonnaise, Eierlikör,
- als Lockerungsmittel in Süßspeisen,
- als Treibmittel in Backwaren, Souffles,
- als Klärmittel in Brühe, Aspik.
In der Deklaration von Nahrungsmittel muss man auf Begriffe wie Vollei, Eiklar, Weissei, Eigelb, aber auf Wörter mit der Vorsilbe äOvo-...ô achten.In manchen Speisen vermutet man auf Anhieb kein Eiereiweiß. Daher nachfolgende Aufzählung als kleine Hilfe. Ei ist vielfach enthalten in: Fertigsalaten, panierten Gerichten, Gemüse-Fertiggerichten, Zwieback, Nudelgerichten, Wermuthweinen wie Campari, Speiseeis, Lebkuchen, Negerküssen, Zuckerwatte, vielen Bonbons, Saucen, Hefezopf, Semmelknödel, Frikadellen.
Um den Proteinbedarf auch ohne Eier zu decken, empfiehlt sich eine ausgewogene Ernährung.
* * * * * * *
Tierhaarallergie
Das eigentliche Allergen sind nicht die Haare der Tiere selbst, sondern stammt aus dem Schweiß, Talg, Speichel oder Urin der Tiere. Diese haften an den Haaren und werden mit den Haaren und dem Staub in der Luft verbreitet. Landen sie auf den Schleimhäuten der Augen, der Nase oder den Bronchien, so können sie eine allergische Reaktion auslösen, wenn der Betreffende auf die jeweilige Tierart sensibilisiert ist.
Die Tierhaare können sich auch an Kleidungsstücke heften. Hierbei kann ein Betroffener sogar schon eine allergische Reaktion zeigen, wenn er z.B. neben jemandem sitzt, an dessen Kleidung sich solche Tierhaare bzw. -hautschuppen befinden. Auf diese Weise kommt es vor, dass jemand, der zu Hause z.B. eine Katze hat, das Katzenallergen mit an seine Arbeitsstätte oder in andere Wohnungen transportieren kann, wo dann ein Kollege, der auf Katzenhaare allergisch reagiert, die typischen allergischen Reaktionen entwickelt. Zu gesundheitlichen Beschwerden kann es bei entsprechend hoch sensibilisierten Tierhaarallergikern auch kommen, wenn sie einen Raum betreten, in dem vorher ein Tier war, auf das sie allergisch reagieren.
Katzen
Das Katzenallergen wird hauptsächlich mit dem Speichel und der Tränenflüssigkeit abgegeben und benetzt auf diese Weise den Feinstaub in der Wohnung, der allergische Reaktionen auslöst. Durch die außerordentlich guten Schwebeeigenschaften dieses Feinstaubes verbleibt das Katzenallergen selbst nach Entfernen der Katze aus der Wohnung noch über Monate in der Luft.Untersuchungen haben gezeigt, dass das Katzenallergen auch in Räume transportiert wird, in denen sich niemals ein Tier aufgehalten hat. So konnte es in Kindergärten in Konzentrationen nachgewiesen werden, die ausreichen, um bei entsprechend sensibilisierten Kindern Allergien und Asthmaanfälle auszulösen. Das Katzenallergen wurde in diesen Fällen über die Kleidung von Kindern, die zu Hause eine Katze hatten, in den Kindergarten hineingetragen und war bei Untersuchungen des Staubes in der Raumluft nachweisbar.
Hunde
Hundehaarsensibilisierungen können rassenspezifisch verlaufen. Hier sollte im einzelnen getestet werden, ob eine Sensibilisierung gegen den eigenen Hund vorliegt. Die Allergene von Hundehaaren weisen im Vergleich zum Katzenallergen ein geringeres Sensibilisierungspotential auf, das Allergen verbleibt auch nicht in der zuvor beschriebenen Weise in der Raumluft.
Vögel
Vögel können ebenfalls Allergien auslösen. Auslöser sind hier sowohl die Federn als auch der Vogelkot. Auch können Vogelmilben die Ursache sein. In diesem Fall besteht oft zusätzlich eine Sensibilisierung gegen Hausstaubmilben. Die Symptome - meist direkte Luftnotanfälle - treten hierbei u.a. nach dem direkten Kontakt mit dem Vogel und nach Reinigung der Käfige auf.
Ein anderer Krankheitstyp mit verzögerter Reaktion (Immunkomplexbildung, Typ III) ist bei der sogenannten "Vogelhalterlunge" gegeben. Diese häufiger bei Taubenzüchtern anzutreffende Erkrankung zeigt sich ca. 3 bis 6 Stunden nach dem letzten Vogelkontakt mit Symptomen wie Fieber, Husten, Schüttelfrost, Übelkeit, Luftnot. Wird bei diesem Krankheitsbild eine weitere Exposition mit diesen Tieren nicht vermieden, kann sich ein lebensbedrohlicher Krankheitszustand einstellen.
Kann man gegen alle Tiere allergisch sein?
Nein, zumindest ist ein solcher Fall noch nicht bekannt geworden. Am häufigsten sind Allergien nur gegen Katzen oder nur gegen Pferde usw.. Bei einer Hundehaarallergie kann die Allergie auf eine oder wenige Hunderassen begrenzt sein. Die sicherste Behandlungsmöglichkeit bei einer Tierallergie ist zweifelsohne die Entfernung des entsprechenden Tieres aus der Umgebung des Allergikers.Vorsicht ist für einen Tierhaarallergiker auch bei Kleidungs- und Einrichtungsgegenständen aus Tierhaaren geboten. Denn auch Felle, Kleidungsstücke, Teppiche und alle anderen Gegenstände, die aus Tierhaaren gefertigt sind, können auch deren Allergene enthalten (z.B. Kamelhaarmäntel, Rosshaarmatratze, Teppiche aus Tierfell oder Schaffell für Kinder)
***********************************************************************
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-11-10 19:07:44 mit dem Titel Was ist Asthma?
Eine sehr gut Freundin von mir hat Asthma.
Es ist manchmal richtig übel, wenn sie einen Anfall bekommt, sie ist danach immer so fertig und schläft viel.
sie hat mir einige texte zur information gegeben, da ich das wichtig finde darüber bescheid zu wissen.
***********************************************************************
Was ist Asthma?
Kennzeichen des Asthma bronchiale sind die Verkrampfung der Muskeln in der Bronchialwand, die Schwellung der Bronchialschleimhaut und die Produktion von zähem Schleim. Dabei ist die Bronchialschleimhaut eines Asthmatikers in typischer Weise entzündlich verändert. Das auffälligste Symptom ist die keuchende Atmung, die in plötzlichen Anfällen auftritt. Charakteristisch sind auch Husten, Giemen, eine Engegefühl in den Atemwegen, Kurzatmigkeit und Atemnotanfälle, die als Folge unterschiedlichster Reize auftreten können.
Für die moderne Asthma-Therapie stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung, die zum einen bronchienerweiternd, zum anderen entzündungshemmend wirken. Ihre Anwendung erfolgt abgestuft entsprechend dem Schweregrad des Asthma bronchiale, an dem der Betroffene leidet. Die Ziele der Asthma-Therapie sind dabei die Vermeidung von Asthma-Anfällen, die Verhinderung einer krankheitsbedingten Beeinträchtigung des täglichen Lebens und eine Wiederherstellung und Erhaltung einer normalen Lungenfunktion.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass das Asthma auf einer Entzündung der Bronchialschleimhaut beruht, steht heutzutage die entzündungshemmende Behandlung im Vordergrund. Die bronchialerweiternde Behandlung dient zur raschen und vorübergehenden Lösung der Bronchialverengung und damit zur subjektiven Erleichterung, behandelt das Asthma jedoch nur symptomatisch und hat keinen nachhaltigen Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Um chronischen und irreversiblen Schäden vorzubeugen, wird auch bei leichtgradigem Asthma schon frühzeitig mit der entzündungshemmenden Behandlung begonnen.
Bei allen Asthmatherapie-Stufen werden bronchialerweiternde ß2-Sympathomimetika "nach Bedarf" inhaliert, wenn Atembeschwerden auftreten, oder vorbeugend vor größeren körperlichen Belastungen wie z.B. vor der Ausübung von Sport. Diese vorbeugende Inhalation führt dazu, dass der betroffene Asthmatiker seine Sportart ohne Beschwerden in der Regel 2 bis 4 Stunden durchführen kann. Im Fall von Atembeschwerden reicht es aus, ein oder maximal zwei Hübe zu inhalieren. Wenn sich daraufhin innerhalb von 5 Minuten keine Besserung einstellt, ist eine Notfallbehandlung erforderlich. Treten Atembeschwerden häufiger pro Tag auf, so dass täglich mehr als 10 Hübe eines ß2-Sympathomimetikums benötigt werden, muss die Basistherapie neu eingestellt werden (Arzt aufsuchen). In der Regel ist dann eine Erhöhung der Glukokortikosteroiddosis oder zusätzlich eine Theophyllin-Therapie erforderlich.Auch schon bei leichtem Asthma sollte eine regelmäßige Inhalation von entzündungshemmenden Medikamenten erfolgen.
Die Inhalation der Medikamente ist mit geringeren Nebenwirkungen als die systemische oder orale Einnahme (Tabletten, Spritzen) verbunden. Daher wird generell den inhalativen Medikamentenformen der Vorzug gegeben. Denn bei der Inhalation gelangt der Wirkstoff direkt in die Bronchien, wo er auch seine Wirkung entfalten soll. Außerdem liegt der Wirkstoff in einer gut fettlöslichen, jedoch schlecht wasserlöslichen Form vor, so dass bei der Inhalation verschluckte Wirkstoffmengen nicht aufgenommen und über den Blutkreislauf verteilt werden.Da der Wirkstoff bei der Inhalation direkt in die Bronchien gelangt, wo er auch benötigt wird, bleiben die gefürchteten Kortison-Nebenwirkungen bei der Verwendung von inhalativen Glukokortikoiden aus.
***********************************************************************
Therapie/Medikation
Die Luftnot beim Asthma bronchiale wird durch eine Verengung der Luftwege, der Bronchien, hervorgerufen. Ein Leben mit Asthma bedeutet jedoch nicht ein Verlust an Lebensqualität.
Für die Luftnot werden drei Gründe ins Feld geführt:
Die Schleimhaut der Bronchien ist entzündet, geschwollen und verdickt. Dadurch verringert sich der Innendurchmesser der Bronchien.
Die entzündete Schleimhaut produziert einen zähen, stark haftenden Schleim, der sich nur schwer abhusten läßt und die Bronchien teilweise oder völlig verstopfen kann.
Die Muskulatur der Bronchien zieht sich auf bestimmte Reize (Anstrengung, Temperaturwechsel, Rauch) hin zusammen und verkrampft sich (Bronchospasmus), wodurch sich der Innendurchmesser der Bronchien noch mehr verengt.
Asthma
Medikamente
Die Asthmamedikamente lassen sich entsprechend ihres Wirkprinzips unterteilen in:Bronchodilatatoren, die der Verkrampfung der Bronchialmuskulatur entgegenwirken und anti-entzündliche Medikamente, die der Entzündung der Bronchialschleimhaut entgegenwirken und damit deren Schwellung und die Schleimabscheidung reduzieren.
ß2-Sympathomimetika. Sie bewirken eine Erweiterung der Bronchien, indem sie die Bronchialmuskulatur erschlaffen lassen. Da diese Wirkung sehr schnell eintritt, sind sie als Notfallmedikamente zur Abwendung eines akuten Asthmaanfalls geeignet. Weitere, jedoch schwächere Wirkungen der ß2-Sympathomimetika, sind eine Verbesserung des Schleimabtransportes der Bronchialschleimhaut und eine Stabilisierung der Mastzellen, wodurch allergische und entzündliche Reaktionen verringert werden.
Anticholinergika. Sie wirken ebenfalls bronchialerweiternd, zeigen jedoch einen langsameren Wirkungseintritt. Im Vordergrund der Behandlung mit Anticholinergika steht der Schutz vor den reflektorischen, durch physikalische (z.B. Kälte, Husten, Fremdkörper) oder chemisch-irritative (z.B. Zigarettenrauch) Reize ausgelösten Verengungen der Bronchien.
Cromoglicinsäure (DNCG) und Nedocromil. Dies sind zwei Substanzen, deren Wirkung auf einer Stabilisierung der Mastzellen und einer Hemmung anderer, an den Entzündungsprozessen beteiligten Zellen beruht. Sie wirken damit anti-entzündlich. Die Wirkung ist protektiv; bei einer dauerhaften Anwendung bieten diese Arzneien Schutz vor Bronchokonstriktion, die durch Allergene, andere inhalative Reize (Rauch, Kaltluft) und durch körperliche Belastung ausgelöst werden. In einem akuten Anfall haben DNCG und Nedocromil keine Wirkung. Daher werden diese Medikamente im Rahmen einer Dauertherapie, vor allem bei leichtem Asthma eingesetzt.
Methylxanthine (Theophyllin). Die Methylxanthine, zu denen das Theophyllin und das Coffein gehören, wirken entspannend auf die Bronchialmuskulatur und erweitern damit die Bronchien. Methylxanthine werden in der Dauertherapie eingesetzt. Theophyllin-Präparate werden meist als Retard-Tabletten verwendet. Sie geben ihren Wirkstoff meist erst nach und nach frei (retardiert = verzögert), um so über mehrere Stunden einen gleichmäßig hohen Theophyllinspiegel im Blut aufrechtzuerhalten.
Kortikosteroide. Dies sind Abkömmlinge des natürlichen Nebennierenrindenhormons Kortison und die wirksamsten anti-entzündlichen Medikamente. Sie wirken der Entzündung entgegen und haben eine anti-allergische Wirkung. Bei dauerhafter Anwendung bewirken sie ein Abschwellen der Bronchialschleimhaut, verringern die Schleimproduktion, hemmen die allergische Reaktionen und vermindern die bronchiale Hyperreagibilität.
Kortikosteroide werden als anti-entzündliche Dauertherapie des Asthmas verwendet. Die Anwendung per Inhalation bewirkt, daß das Medikament direkt seinen Wirkort, die Bronchialschleimhaut, erreicht; systemische Nebenwirkungen werden dabei vermieden. Die Wirkung der inhalativen Kortikosteroide ist vorbeugend. Bis zum vollen Wirkungseintritt dauert es mehrere Tage bis Wochen, dafür hält die Wirkung durch das Abklingen der Entzündung auch nach dem Absetzen dieser Medikamente lange an.
Die Einnahme systemischer Kortikosteroide (in Tablettenform) ist bei schwerem Asthma als Dauertherapie erforderlich. Die Dosierung ist in Abstimmung mit dem Arzt so gering wie möglich, jedoch so hoch wie erforderlich zu wählen. Bei einer langandauernden hochdosierten Anwendung können Nebenwirkungen auftreten. Bei akuten Anfällen, kann eine einmalige hohe Kortikoiddosis systemisch verabreicht werden (Tablette, Spritze), ohne Nebenwirkungen befürchten zu müssen.
**********************************************************************
Der Therapiestufenplan
Da Asthma auf einer Entzündung der Bronchialschleimhaut beruht, steht die anti-entzündliche Behandlung im Vordergrund. Die bronchialerweiternde Behandlung dient zur raschen und vorübergehenden Lösung der Bronchialverengung, behandelt das Asthma jedoch nur symptomatisch und hat keinen nachhaltigen Einfluß auf den Krankheitsverlauf.
Die Ziele der Asthma-Therapie sind das Vermeiden von Asthma-Anfällen, die Verhinderung einer krankheitsbedingten Beeinträchtigung des täglichen Lebens und eine Wiederherstellung und Erhaltung einer normalen Lungenfunktion.
Entsprechend des Asthma- Schweregrades wurde ein dreistufiges Therapie-Schema erstellt. Neben der Häufigkeit, mit der die Asthmasymptome auftreten, dient die Überprüfung der Lungenfunktionswerte der Einordnung in die drei Schweregrade. Die Medikation wird dem jeweils aktuellen Schweregrad angepaßt. Besondere Bedeutung kommt dem Peak-Flow-Wert zu, den jeder Asthmatiker mittels eines handlichen Peak-Flow-Meters täglich selbst überprüfen sollte.
Bei allen Asthmatherapie-Stufen werden bronchialerweiternde ß2-Sympathomimetika "nach Bedarf" inhaliert, wenn Atembeschwerden auftreten, oder vorbeugend vor größeren körperlichen Belastungen. Diese vorbeugende Inhalation führt dazu, daß der betroffene Asthmatiker Sport ohne Beschwerden in der Regel zwei bis vier Stunden durchführen kann. Im Fall von Atembeschwerden reicht es aus, ein oder maximal zwei Hübe zu inhalieren. Wenn sich daraufhin innerhalb von fünf Minuten keine Besserung einstellt, ist eine Notfallbehandlung erforderlich. Treten Atembeschwerden häufiger auf, so daß täglich mehr als zehn Hübe eines ß2-Sympathomimetikums benötigt werden, muß die Basistherapie vom Arzt neu eingestellt werden.
Auch schon bei leichtem Asthma (Stufe 1) sollte eine regelmäßige Inhalation von anti-entzündlichen Medikamenten erfolgen. Als nicht-steroidale Substanzen stehen Cromoglicinsäure (DNCG) und Nedocromil zur Verfügung. Kommt es jedoch trotz täglicher Anwendung von DNCG bzw. Nedocromil innerhalb von vier bis sechs Wochen nicht zu einer Stabilisierung der Peak-Flow-Werte und einer Abnahme tageszeitlicher Schwankungen, darf nicht gezögert werden, ein inhalatives Kortikosteroid einzusetzen.
Bei mittelschwerem Asthma in der Therapiestufe 2 erfolgt die anti-entzündliche Basisbehandlung mit der regelmäßigen Inhalation eines Kortikosteroids. Um nächtlichen Asthmaanfällen vorzubeugen, wird häufig ein retardiertes Theophyllin-Präparat verordnet. Alternativ kann ein langwirkendes ß2-Sympathomimetikum inhaliert werden.
Bei schwerem Asthma in der Therapiestufe 3 kommt erweiternd die Einnahme von Kortikoiden in Tablettenform hinzu.
*********************************************************************
Therapie
Selbstmanagement
Als Peak-Flow bezeichnet man die maximale Atemstromstärke, die bei maximaler Ausatmung erreicht wird. Je enger die Bronchien sind, desto geringer fällt der Wert aus. Die Peak-Flow-Werte sind auch die Grundlage der Einteilung des Asthmas in die drei Schweregrade.
Die tägliche Peak-Flow Messung dient dazu, daß jeder Asthmatiker eine Einschätzung seines momentanen Atemwegszustands bekommt und seinen Krankheitsverlauf besser verstehen und nach dem Stufenplan in Absprache mit dem Arzt selbst kurzfristig reagieren kann. Routinemäßige Messungen des Peak-Flow sollten morgens nach dem Aufstehen und abends durchgeführt werden. Zusätzliche Messungen sind bei Gefühl von Atemnot, bei Bronchialinfekten, bei Therapieum- oder -neueinstellungen, bei stärkeren Abweichungen vom persönlichen Peak-Flow-Bestwert oder größeren Schwankungen angeraten.
Der Therapie-Plan für das Selbst-Management beruht wesentlich auf den gemessenen Peak-Flow-Werten. Der wichtigste Wert ist dabei der persönliche Peak-Flow-Bestwert, also der höchste Wert, der bei langfristiger Messung und Protokollierung der täglichen Werte erreicht wird. Ausgehend von der Basismedikation für die Dauertherapie wird vom Arzt in Zusammenarbeit mit dem Patienten ein Plan aufgestellt, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, wenn sich die Atemwegssituation verschlechtert, d.h. der Peak-Flow bestimmte Schwellenwerte unterschreitet. Dabei werden drei Zonen unterschieden:
Grüne Zone: Alles in OrdnungDer aktuelle Peak-Flow-Wert beträgt 80 bis 100 Prozent des persönlichen Bestwertes.
Gelbe Zone: Achtung! Maßnahmen erforderlich.
Der aktuelle Peak-Flow-Wert fällt auf 50 bis 80 Prozent des persönlichen Bestwertes und die Asthmasymptome werden häufiger. Als Maßnahme werden ß2-Sympathomimetika inhaliert und entsprechend dem aufgestellten Therapieplan weitere Medikamente (z.B. Kortikosteroide, Theophyllin) eingenommen. Wenn sich die Symptome wiederholen, sollte der Arzt aufgesucht werden. Meist ist dann die Basistherapie neu einzustellen.
RoteZone:Notfallprogramm
Der aktuelle Peak-Flow-Wert fällt unter 50 Prozent des persönlichen Bestwertes und es besteht Atemnot in Ruhe oder bereits bei leichter körperlicher Betätigung. Jetzt müssen sofort ß2-Sympathomimetika inhaliert und bei ausbleibender Besserung entsprechend dem aufgestellten Notfallplan Kortison-Tabletten eingenommen werden. Wenn dann nach 30 Minuten immer noch Atemnot herrscht oder der Peak-Flow-Wert sich nicht entscheidend gebessert hat, muß sofort ein Arzt aufgesucht werden.
*********************************************************************
Verhalten bei Infekten
Atemwegsinfekte steigern die Empfindlichkeit (Hyperreagibilität) der Bronchien, was zu einer Verstärkung der asthmatischen Beschwerden führt. Bei den ersten Anzeichen eines Atemwegsinfekts muß die Asthma-Therapie intensiviert werden. Zur Kontrolle sind häufigere Peak-Flow-Messungen notwendig (4-6mal pro Tag). Die anti-entzündliche Basistherapie muß verstärkt werden. Entsprechend der Absprache mit dem Arzt wird häufiger mit DNCG oder Kortikosteroiden inhaliert. Eventuell ist auch eine kurzandauernde systemische Kortikosteroid-Therapie (Kortikosteroide in Tablettenform) erforderlich. Wenn Theophyllinpräparate eingenommen werden, sollte die Dosis verringert werden, da bei einer Infektion der Theophyllinabbau verlangsamt ist. Die angewendete Intensivtherapie wird noch mindestens eine Woche nach Abklingen des Infekts beibehalten, um eventuellen Rückfällen vorzubeugen. Da die bronchiale Hyperreagibilität auch nach dem Abklingen des Infekts noch wochenlang verstärkt sein kann, ist eine ausreichende Dauer der medikamentösen anti-entzündlichen Nachbehandlung wichtig.
Peak-Flow-MessungUm korrekte und vergleichbare Werte zu erhalten, ist zu beachten:
Möglichst immer in der gleichen Körperhaltung messen.
Die Anzeigemarke der Meßskala auf den Nullwert zurückschieben.
Das Peak-Flow-Meßgerät waagerecht vor den Mund halten; dabei die Meßskala nicht mit den Fingern abdecken, um nicht den Zeigerausschlag zu behindern.
So tief wie möglich einatmen und die Luft kurz anhalten.
Den Mund öffnen und das Mundstück mit den Lippen fest umschließen.
Kurz und mit aller Kraft ausatmen.
Durch den Atemstoß wird die Anzeigemarke der Meßskala verschoben. Der angezeigte Meßwert entspricht der maximalen Atemstromstärke (Peak-Flow-Wert).
Die Peak-Flow-Messung noch zweimal wiederholen (Punkte 1-7).
Den höchsten Peak-Flow-Wert der drei Messungen im Asthma-Tagebuch notieren.
Wichtig: Bei den Messungen ist darauf zu achten, daß die Ausatmung nur kurz erfolgt und nicht zu lang ausgeatmet wird, da ansonsten Asthmaattacken ausgelöst werden könnten.
***********************************************************************
Den Alltag leichter meistern
Ausreichende Bewegung,
Ausdauersport wie Wandern, Fahrradfahren und vor allem Schwimmen,
Verzicht auf Nikotin,
Gewicht kontrollieren, Übergewichtige haben mehr Probleme mit ihrem Asthma,
Bei Cortisoneinnahme: ausreichend Calcium durch die Ernährung aufnehmen,
Entspannungstechniken- wie Autogenes Training- erlernen,
Atemgymnastik machen, Techniken wie die Lippenbremse erlernen,
Asthmaschulungen besuchen,
Infektionen vorbeugen durch "Abhärtung" wie Sauna, Wechselduschen- sofern es vertragen wird,
Sich einer Gruppe im Deutschen Allergie- und Asthmabund anschließen,
Sofern ein allergisches Asthma vorliegt, möglichst die auslösenden Allergene vermeiden. weiterlesen schließen -
Wie aus einem Hexenschuß ein Feenkuß wurde - ABC-Pflaster

09.11.2002, 13:21 Uhr von
LillyMarlene
Hallo Yopianer, ich denke es wurde Zeit für ein Update und schreibe jetzt mal was über mich, viel...Pro:
Sehr schnelle Wirkung
Kontra:
Die sehr starke Hitze stört doch etwas
Empfehlung:
Nein
Seit Mittwoch quäle ich mich jetzt mit einem Hexenschuß rum und wer das auch schon mal hatte, weiß was das für Schmerzen sind. Jede Bewegung wird zur Qual und jeder Schritt fühlt sich an, als ob Messer in die Beine aufritzen würden. Denn der Ischiasnerv zieht leider bis in die Beine. Probleme habe ich damit immer im Herbst und Frühjahr und jedesmal setzt mich so ein Hexenschuß gleich für mehrere Tage ausser Gefecht. Eingefangen habe ich mir meinen, als ich mich am Dienstag bei ziemlich kaltem Wind auf eine Bank an der Bushaltestelle gesetzt hatte :-(
Heute morgen war ich es dann leid, nur im Bett mit dem Heizkissen im Rücken zu liegen, schließlich habe ich einen Haushalt und 2 Kinder zu versorgen und so schicke ich meinen Mutter in die Apotheke um mir etwas gegen die Schmerzen zu besorgen und sie kam wieder mit einem ABC-Pflaster und das möchte ich Euch jetzt mal vorstellen
Das Produkt
ABC-Pflaster ist von Hansaplast und in ein Wärme-Pflaster, das auf die betroffene Hautstelle geklebt wird. Durch seine weiche Form läßt es sich hervorragend an alle Stellen des Körpers kleben und verruscht auch nicht oder geht wieder ab. Mit den Maßen 14 x 10 cm ist es recht groß, so das auch großflächig behandelt werden kann. In einer Tüte befinden sich 5 Pflaster, die 4 bis 8 Stunden auf der Haut bleiben soltle und dann erst wieder nach 12 Stunden erneuet angewendet werden darf. Auch sollte man anschließend auf weitere Wärme wie z. B. Heizkissen verzichten. Das Pflaster wird heiß, sehr heiß, aber genau dadurch setzt es seine Wirkung frei.
[bVerpackung]
In der Verpackung sind 5 Pflaster und der Preis von 7,50 Euro finde ich dafür gerechtfertig. Die etwas festere Papiertüte verfügt über einen Wiederverschluß, so das die Pflaster hygienisch gelagert werden können. Auf der Verpackung steht groß Hansaplast und darunter ABC Wärme-Pflaster. Ich nehme die Sensitiven, denn ich möchte Hautreizungen vermeiden.
Hersteller
Pharmazeutisches Unternehmen ist die Beiersdorf AG in Hamburg, hergestellt wird es allerdings in Japan von der Firma Teikoku Seiyaku Co. LTD.
Anwendungsgebiet
Zur gezielten Behandlung bei rheumatischen Beschwerden wie z. B. Ischias, Hexenschuss, Nackensteifheit, Schulter-Arm-Schmerzen sowie Muskelverspannung-, zerrungen, Muskelkater, Muskel-Gelenk- und Nervenschmerzen im Bereich des Bewegungsapparates, hervorrgerufen durch z. B. Überanstrengung, Zugluft oder Erkältung.
Nebenwirkungen
Bei empfindlicher Haut sollte man auf das Pflaster verzichten und als Nebenwirkung kann in seltenen Fällen eine Überempfindlichkeit der Haut auftreten in Form von Quaddeln oder Bläschenbildung. Der Arzneiliche Bestandteil ist Nonivamid und wer darauf allergisch reagiert, sollte von dem Pflaster absehen.
Fazit
Ich habe das Pflaster jetzt etwa eine Stunde auf dem Rücken kleben und ich merke, wie die Schmerzen deutlich abnehmen. Etwas unangenehm empfinde ich mittlerweile die Hitze, aber die muß ja nunmal sein, sonst könnte es nicht wirken. Wer allerdings stark drauf reagiert, sollte es nicht nehmen. Noch kann ich es allerdings aushalten und werde tapfer durchhalten, denn ich ertrage lieber die Wärme, als die Schmerzen. Auch sind die Bewegungen nicht mehr ganz so eingeschränkt und ich kann schon wieder umherlaufen, ohne das mir die Beine und das Kreuz so weh tun.
Ich kann das Pflaster wirklich empfehlen. Denn mit wenig bis gar keinen Aufwand hat meine die Schmerzen schnell im Griff und das ist das, was zählt. Natürlich ersetzt so ein Pflaster keinen Artz, aber helfen kann man sich damit sehr gut. weiterlesen schließen -
Aids
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Nein
Was ist Aids :
Der Begriff AIDS steht für eine erworbene Abwehrschwäche des Körpers.
Diese Abwehrschwäche wird durch das Immunschwächevirus HIV verursacht.
Dieses Virus hat die Fähigkeit, bestimmte Zellen anzugreifen, die für die körpereigene Abwehr von Krankheitserregern zuständig ist.
Das Virus dringt in die Zellen ein und zwingt sie dazu, neue Viren zu produzieren. Diese Zellen können ihre Abwehrfunktion nicht mehr ausfüllen und gehen zugrunde.
Irgendwann, bei uns in Deutschland nach durchschnittlich 10 Jahren, ist das Immunsystem der Übermacht der Viren nicht mehr gewachsen und bricht zusammen.
Wie bekommt man Aids :
Ungeschützter Geschlechtsverkehr ...
...ist nach wie vor der Hauptübertragungsweg des HI-Virus.
Schon ein einziger ungeschützter Kontakt kann zur Infektion führen
Neuere Untersuchungen zeigen, dass kurz nach der Infektion die Ansteckungsgefahr für den Partner/die Partnerin besonders hoch ist, also genau in dem Zeitraum, in dem eine Infektion mit dem HI-Virus noch nicht durch den HIV-Test nachgewiesen werden kann.
D.h. dass Dein(e) Partner(in) vielleicht selber noch gar nicht wissen kann, dass er/sie infiziert ist!
HI-Viren im Samen oder in der Scheidenflüssigkeit brauchen nicht unbedingt offene Wunden, um in den Körper zu gelangen, auch die Schleimhäute sind Eintrittspforten für das Virus. Geschlechtskrankheiten oder Verletzungen erhöhen die Gefahr einer Ansteckung.
--------------------------------------------------------------------------------
Oralverkehr
Auch über die Mundschleimhaut können Viren aus dem Sperma oder dem Scheidensekret übertragen werden, das Risiko wird jedoch als gering eingeschätzt. Hier gilt: es ist immer der/die Aktive der das höhere Risiko trägt, d.h. derjenige, der Samen oder Scheidenflüssigkeit mit dem Mund aufnimmt. Um zu verhindern, dass Sperma in den Mund gelangt, sollte am besten ein Kondom benutzt werden.
--------------------------------------------------------------------------------
Analverkehr
Bei ungeschütztem Analverkehr (Darmverkehr) besteht ein hohes Infektionsrisiko. Hierbei kommt es besonders leicht zu Verletzungen der sehr empfindlichen Darmschleimhaut, die eine Ansteckung begünstigen. Beide Partner sind gefährdet, der/die Passive jedoch wesentlich höher. Es sollten auf jeden Fall Kondome (für den Analverkehr gibt es speziell starke Kondome) und ausreichend fettfreie Gleitcreme (z. B. KY-Gel) verwendet werden.
--------------------------------------------------------------------------------
Fixen
Gemeinsamer Gebrauch von Spritzen und Nadeln beim Fixen birgt ein sehr hohes Infektionsrisiko. Deshalb: jedes Mal eine sterile Spritze und den eigenen Löffel verwenden und nicht untereinander weitergeben.
Petting
Die Haut des Menschen hat im Gegensatz zur Schleimhaut eine schützende Hornschicht. Es müssen offene Verletzungen vorliegen, damit Krankheitserreger eindringen können. Das gilt auch für das HI-Virus. Daher ist Petting eine sexuelle Spielart, die Du unbeschwert mit Deinem Partner genießen kannst. Zärtlichkeiten, Streicheln, Umarmen, Massagen, gemeinsam erlebte Selbstbefriedigung ... es gibt viele sichere Möglichkeiten, miteinander Spaß zu haben und sich gegenseitig kennenzulernen. Deiner Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
--------------------------------------------------------------------------------
Küssen
Eine HIV-Übertragung durch intensives Küssen, auch Zungenküssen, wurde bisher nicht beobachtet. Die Anzahl von Viren im Speichel eines HIV-positiven Menschen ist - wenn überhaupt messbar - so gering, dass sie für eine Übertragung der Infektion nicht ausreicht. Auch hat der eigene Speichel Viren- und bakterienabtötende Wirkung. Küssen kommt daher als Übertragungsweg nur theoretisch in Betracht.
--------------------------------------------------------------------------------
Soziale Kontakte
Bei normalen sozialen Kontakten besteht keine Ansteckungsgefahr. Mittlerweile wurden international mehrere hundert Familien mit einem infizierten Familienmitglied beobachtet. Dabei kam es trotz zum Teil sehr schlechter hygienischer Bedingungen nicht zur Infektion anderer Familienmitglieder (Ausnahme: Geschlechtspartner).
--------------------------------------------------------------------------------
Eine Infektion mit dem HI-Virus ist also nicht möglich:
• durch die gemeinsame Benutzung von Toiletten mit HIV-positiven Menschen,
• durch die Pflege von Menschen, die an AIDS erkrankt sind,
• durch den gemeinsamen Gebrauch von Geschirr, Besteck, Gläsern, Wäsche etc.,
• durch den gemeinsamen Genus von Früchten und anderen Esswaren,
• durch Händeschütteln, Umarmen, Streicheln, Massieren und Küssen,
• durch Tränen,
• durch Husten und Niesen,
• durch Insektenstiche und Haustiere,
• durch Anfassen von Türklinken, Telefonhörern, Lichtschaltern usw.,
• in der Schule oder im Kindergarten, auch wenn HIV-positive Kinder diese/n besuchen,
• im Schwimmbad, in der Sauna oder beim Duschen,
• beim Friseur oder im Kosmetiksalon,
• beim Tätowieren, Ohrlochstechen, bei der Akupunktur usw., sofern die dabei üblichen
..Desinfektionsmaßnahmen und Hygieneregeln beachtet werden,
• durch irgendeine Art von Geschlechtsverkehr, sofern er geschützt stattfindet.
Der Aidstest :
Ein HIV-Test darf nur mit Deinem Einverständnis durchgeführt werden. Lass Dich vorher gut beraten und das Ergebnis in einem persönlichen Gespräch mitteilen.
Eine Ansteckung mit dem HI-Virus lässt sich bei den meisten Menschen erst nach 3 Monaten sicher nachweisen.
Ein kürzerer Abstand nach einer möglichen Infektion kann zu einem falschen negativen Ergebnis führen!
--------------------------------------------------------------------------------
In einer ärztlichen Praxis:
Zur Aufklärung von Krankheitsursachen auf Kosten der Krankenkassen (mit anonymisierten Krankenschein).
Wenn Du zur Aufklärung früherer Risiken auf eigenen Wunsch einen Test durchführen lassen möchtest liegen die Kosten bei ca. 60,-- bis 80,-- DM.
Der Arzt, sowie das ärztliche Personal unterliegt einer strengen Schweigepflicht, also keine Angst die Sprache einmal auf so einen Test zu bringen!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Beim Gesundheitsamt:
Die meisten deutschen Gesundheitsämter bieten den Test anonym, kostengünstig, manchmal sogar kostenlos an.
--------------------------------------------------------------------------------
AIDS-Beratungsstellen:
Einige Beratungsstellen bieten die Durchführung des Testes an. Auf jeden Fall kann man sich dort auch telefonisch beraten lassen. Adressen und/oder Telefonnummern erfährst Du beim Gesundheitsamt oder aus dem Telefonbuch.
Ich selber denke das man sich in der heutigen Zeit wirklich schützen sollte.Man kann nicht vorsichtig genug sein und vielleicht sollte man einfach mal mit dem Partner zusammen sollch einen Test machen damit man sich wirklich sicher sein kann.
Ich hoffe das es genug Informationen sind.Bevor mir jemand nachsagt ich hätte den Text geklaut,sage ich euch gleich das ich die Informationen aus dem Internet habe.
Gruss Nadine
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-11-06 12:03:10 mit dem Titel Angst
Angst, allgemein eine Stimmung oder ein Gefühl der Beengtheit, Beklemmung und Bedrohung vor einer drohenden Gefahr, die mit einer Verminderung oder Aufhebung der willens- und verstandesmäßigen Steuerung der eigenen Persönlichkeit einhergeht.
Aus heutiger Sicht wird der Angst ein vielschichtiger Rahmen zugewiesen, der von der konkreten Furcht vor einem bestimmten Gegenstand bis hin zur gegenstandslosen Lebens-, Existenz- und Weltangst reicht. Die individuell unterschiedliche Anfälligkeit für Angstgefühle wird in der Psychologie als Angstneigung definiert. Diese kann, wie andere Persönlichkeitsmerkmale auch, in Fragebögen erfasst und ausgewertet werden. Das zentrale Merkmal der Angst ist ein intensives seelisches Unbehagen, das Gefühl, dass man zukünftige Ereignisse nicht bewältigen kann. Die betreffende Person neigt dazu, sich nur auf die Gegenwart und nur auf die Erledigung einer Aufgabe zu konzentrieren.
Körperliche Symptome :
Körperliche Symptome der Angst sind z. B. Muskelanspannung, schwitzende Handinnenflächen, nervöse Magenbeschwerden, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühle, Schlafstörungen, geistige Blockierung und Herzklopfen. Extreme Angstreaktionen können auch Zittern sowie der plötzliche Kontrollverlust über die Ausscheidungsfunktionen sein. Nach Jeffrey A. Gray sind insbesondere Anzeichen einer bevorstehenden Bestrafung und Frustration Auslöser für Angst. G. Mandler weist zudem auf den kognitiven Aspekt der Angst (siehe kognitive Psychologie) hin, wonach im Mittelpunkt die subjektive Einschätzung steht, der konkreten Situation machtlos ausgeliefert zu sein.
Tatsächlich wurden bis ins späte 19. Jahrhundert die Symptome extremer Angst regelmäßig für Herz- oder Atembeschwerden gehalten. Zu jener Zeit erkannte Sigmund Freud die Angstneurose erstmals als eigenständige Diagnose. Freud glaubte, das Gefühl der Angst trete immer dann auf, wenn das Verhalten einer Person infolge (seiner Ansicht nach instinktgesteuerter) aggressiver oder sexueller Triebe gesellschaftlich nicht akzeptabel sei; die Angst fungiere dann als Auslöser für eine Abwehrreaktion, um diese Triebe zu unterdrücken oder in andere Bahnen zu lenken. Wenn die unbewussten Abwehrmanöver keinen Erfolg hätten, erfolge eine neurotische Angstreaktion. Auf Freud basiert auch die Unterscheidung zwischen Realangst (als angemessene Reaktion auf eine tatsächlich vorhandene Gefahr) und neurotischer Angst (die scheinbar grundlos und unangemessen ist). Letztere hat ihre Ursache demnach in unbewusst empfundenen seelischen Verletzungen (Traumata) und unbewältigten Konflikten.
Die Lerntheoretiker des Behaviorismus sahen die Angst in einem anderen Licht. In Experimenten wurde festgestellt, dass Angst erlernt wird, wenn das angeborene Gefühl der Furcht zusammen mit zuvor als neutral empfundenen Objekten oder Situationen auftritt (Konditionierung). Gewisse Berühmtheit erlangte eine Versuchsanordnung (experimentell erzeugte Angstneurose), bei der ein Kleinkind gleichzeitig mit der Präsentation eines (eigentlich als niedlich empfundenen) weißen Kaninchens einem schmerzhaft schrillen Ton ausgesetzt wurde. Die Angst vor dem lauten Ton übertrug sich unweigerlich auf das Kaninchen, es war damit „angstbesetzt". Weitere Erfahrungen zeigten, dass auf diese Weise erlernte Ängste nur schwer aus dem Bewusstsein zu löschen sind und sich außerdem auf ähnliche Objekte (in diesem Fall alles was weiß und flauschig ist) ausweiten können. Unbestimmte Ängste haben demnach oft ihre Wurzel in derartigen Schlüsselerlebnissen. Die Folge solcher Phobien sind oft mehr oder minder erfolgreiche Vermeidungsstrategien (bei Angst vor Hunden z. B. das Wechseln der Straßenseite), die allerdings zu einer weiteren Verstärkung der Angst und zu bedeutsamen Einschränkungen der Lebensqualität führen können: Im Extremfall wagt sich ein Betroffener überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Nicht zuletzt deshalb sind Phobien behandlungsbedürftig (Verhaltenstherapie).
Psychiater unterscheiden mehrere Geistesstörungen, bei denen Angst das Hauptsymptom ist, z. B. Panikattacken und allgemeine Angststörungen. Panikattacken treten vorübergehend auf, während allgemeine Angststörungen eher chronischer Natur sind. Angststörungen gehören zu den verbreitetsten seelischen Störungen in westlichen Ländern und sind die häufigste seelische Störung in den Vereinigten Staaten, wo sie fast 4 Prozent der Bevölkerung treffen. Es gibt Hinweise darauf, dass Angehörige entsprechend vorbelasteter Familien besonders anfällig für solche Störungen sind. Bewusstseinsbeeinflussende Medikamente, Psychotherapie, Verhaltensmodifikation und Therapien aus dem Bereich der Komplementärmedizin, wie Entspannungstraining, werden allein oder kombiniert zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt.
Ich selber habe starke Angstzustände wenn ich eine Prüfung habe.Ich merke das besonderst beim Auto fahren.Ich bin vor zwei Wochen in der Fahrprüfung durchgefallen.Ich war wie gelehmt,ich habe einfach nur grade aus geguckt und fast nichts gemacht.Am Freitag ist die nächste.
Ich habe die Informationen aus dem Internet,dort kann man sich auch über Therapien zu Angst informieren.
Gruss Nadine weiterlesen schließen
Informationen
Die Erfahrungsberichte in den einzelnen Kategorien stellen keine Meinungsäußerung der Yopi GmbH dar, sondern geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder. Beachten Sie weiter, dass bei Medikamenten außerdem gilt: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
¹ Alle Preisangaben inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versand. Zwischenzeitl. Änderung der Preise, Lieferzeiten & Lieferkosten sind in Einzelfällen möglich. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
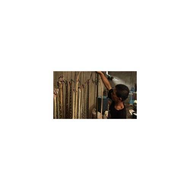

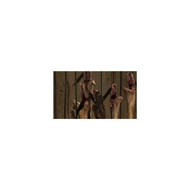

Bewerten / Kommentar schreiben