Bowling for Columbine (VHS) Testberichte
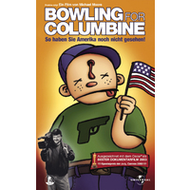
Auf yopi.de gelistet seit 10/2004
Tests und Erfahrungsberichte
-
Are we a nation of gun nuts or are we just nuts?

27.11.2002, 10:27 Uhr von
Bjoern.Becher
Nach 4 Semestern in Freiburg, studiere ich nun Jura in Würzburg. Hier bei YOPI schreibe ich haupt...5Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
Diese Frage ist eines der zentralen Themen in Michael Moores neuestem Dokumentarfilm "Bowling for Columbine", aber nicht das zentrale Thema.
Michael Moore beschäftigt sich in diesem Film mit viel mehr. Er beschäftigt sich nicht nur mit der Waffenverrücktheit der Amerikaner, er beschäftigt sich mit den Ursachen der zahlreichen Massaker in Amerika, er beschäftigt sich mit der Frage warum sich die Amerikaner gegenseitig umbringen, warum in Amerika pro Jahr über 11.000 Menschen durch Schusswaffen sterben, während es in anderen Ländern viel viel weniger sind und er kommt dabei zu Ursachen, die nicht nur Amerika betreffen.
Moore fängt dabei an einem normalen Tag in Amerika an, die Welt ist noch in Ordnung, der Milchmann trägt wie jeden Morgen seine Milch aus und "der Präsident lässt gerade Bomben über einem Land abwerfen, dessen Namen wir nicht mal aussprechen können". Es ist der 20. April 1999, der Tag an dem die beiden Jugendlichen Dylan Klebold und Eric Harris in Littleton, Colorado erst zum Bowlen gehen und wenige Stunden später in der Columbine High School das bis dato größte Schulmassaker verüben.
Dort, nicht unweit von seiner eigenen Heimat, startet Moore seine Reise durch Amerika, auf der Suche nach Antworten auf seine zahlreichen Fragen. Er unterhält sich mit Mitgliedern einer US-Bürgerwehr ("Es ist amerikanische Verantwortung, bewaffnet zu sein. Wenn Du nicht bewaffnet bist, vernachlässigst du deine Pflicht. Wer sonst wird deine Kinder beschützen?"), er unterhält sich mit Terry Nichols, einen Freund des Okalhoma-Attentäter Timothy McVeigh, der auch der Beihilfe zum Attentat verdächtigt wurde, aber freigesprochen wurde, wohl eher zu Unrecht, wenn man sich das Interview ansieht.
Im ersten Teil des Film zeigt Moore durch seine Interviews wie verrückt die Amerikaner nach Waffen sind, er bringt abstruse Beispiele, so eröffnet er in einer Bank ein Konto, wo man dafür ein Gewehr geschenkt bekommt.
Diese erste Teil des Films ist so erschreckend es sich anhört witzig. Durch die Art, in der Moore den Film erzählt, kann man als Zuschauer gar nicht anders, ob der abstrusen Dinge, die da möglich sind, ob der geistigen Verblendetheit einiger Interviewpartner und ob er brillanten Art mit der Moore an die Sache herangeht, zu lachen.
Doch Moore geht weiter. Während er zu Beginn die Absurditäten aufzeigt, seine Interviewpartner bloßstellt, geht er danach über zur Ursachenforschung. Warum bringen die Amerikaner sich um, warum passieren die Massaker? Gewalt in Filmen! Heavy Metal! Die amerikanische Geschichte! South Park! Marilyn Manson! Marilyn Manson! Marilyn Manson! Das sind die Antworten, die er bekommt und immer wieder Marilyn Manson, also unterhält sich Moore mit diesem und auch mit einem der Erfinder von South Park, der übrigens auch Schüler an der Columbine High School war und bekommt zum ersten Mal andere Antworten. Tiefergehende Antworten, als die üblichen Schuldzuweisungen der Experten. Die Angst vor dem Versagen, mit der man immer wieder konfrontiert wird, die Angst sie ist die Ursache.
Moore zeigt dies weiter in einem amüsanten Comic, verpackt darin in 3 Minuten die Geschichte von Amerika und immer wieder kommt die Angst der Amerikaner darin vor, die Angst vor den Indianern, dann den Schwarzen und mittlerweile vor den Nachbarn. Er geht nach Kanada, zu den nördlichen Nachbarn, wo es kaum Tote durch Schusswaffen gibt, und das obwohl die Kanadier genauso waffenverrückt sind, wie die Amerikaner, aber die Kanadier haben keine Angst. Die Haustüren stehen offen, während in Amerika jeder mindestens 3 Sicherheitsschlösser hat. Und die Waffen in der Hand einer paranoiden Gesellschaft sind erst das Problem, aber nicht das einzige.
Hier spannt Moore den Bogen über die ganze Welt. Er zeigt die Probleme zwar an den Amerikanern, er macht sich aber nicht über seine Landsleute lustig, er ist stolz auf sein Land, das merkt man. Er zeigt als große Ursache das mangelnde Sozialsystem. Er zeigt eine Mutter, die um ein bisschen Geld zu verdienen, welches nicht mal zum Leben reicht, 2 Jobs haben muss und jeden Tag eine weite Strecke mit dem Bus zurück legen muss, so dass sie sich nicht um ihren sechsjährigen Sohn kümmern kann und dieser findet eine Pistole und bringt in der Schule eine Mitschülerin um. Dies könnte überall auf der Welt passieren, doch es passiert nur in Amerika. Warum? Weil es in Kanada ein Sozialsystem gibt, und auch in Deutschland und auch sonst über all auf der Welt, nur in Amerika nicht. Er klagt damit auch das System in Amerika an, dass nur die Reichen unterstützt und der Rest soll sich selber helfen.
Bowling for Columbine ist kein antiamerikanischer Film, Bowling for Columbine zeigt Probleme, die es auf der ganzen Welt gibt, die in Amerika nur in einem extrem hohen Ausmaß vorhanden sind, aber überall auf der Welt auftreten können.
Bowling for Columbine ist ein äußerst facettenreicher Film. Er hat lustige Momente, doch dies ist nicht die Hauptintention des Films. Er will nicht nur unterhalten, dazu wäre das Thema ein falsches, er will zum Nachdenken anregen und bei mir hat er dies geschafft und ich denke auch bei der Mehrheit der Zuschauer. Bowling for Columbine macht nachdenklich über eine von Angst dominierte Gesellschaft, deren Auswirkungen auch in Deutschland zu sehen sind. Auch bei uns, in Deutschland, hören und sehen wir in den Nachrichten fast nur Horrormeldung von Kinderentführungen und von Sexualtriebtätern. Auch in Deutschland, da bin ich mir sicher, würden sich die Menschen so bewaffnen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, wie es die Menschen in Amerika haben, deren Recht auf Waffen in dem zweiten Verfassungszusatz tief verankert ist. Es sind nicht die Amerikaner die spinnen, es ist die Gesellschaft die spinnt, eine Gesellschaft, in der mit der Angst der Menschen Geld gemacht wird, statt versucht wird diese abzubauen.
Kann man Bowling for Columbine als zu einseitig kritisieren, habe ich mich gefragt. Nein, denke ich. Moore bezieht eine einseitige Position, aber nicht die gegen Waffen. Er ist selbst langjähriges NRA-Mitglied (NRA=National Rifle Association, die Gesellschaft, welche am stärksten für das Recht auf Waffen eintritt), er besitzt Waffen. Moore bezieht eine einseitige Position gegen die geschürte Angst, die vielen Leuten auch zur Macht verhilft, eine Position gegen all die Experten, die immer und immer wieder nur die gleichen Antworten wissen, auf die Frage, wer schuld an einem Massaker sei, aber blind sind für die Erforschung der wirklichen Ursachen.
Moore schreibt dabei dem Zuschauer aber nicht vor, was dieser denken soll, nein das Gegenteil ist der Fall, Moores Film ist ein Denkanstoß, er regt zum Nachdenken an und zum diskutieren an. Und Moores Film hat schon eins erreicht: Durch die Dreharbeiten und das harte Nachbohren von Moore hat die Supermarktkette, bei welcher die Attentäter von Littleton ihre Munition gekauft haben, jegliche Schusswaffen-Munition aus ihrem Sortiment genommen.
Moores Film ist eine Achterbahnfahrt über 122 Minuten bewegende Minuten. Es ist für einen selbst erschreckend, wie komisch manche Szenen sind, aber der Film macht auch betroffen. Moore versteht es dazu perfekt die Bilder mit der Musik zu verknüpfen, ich habe selten ein größeres Kunstwerk gesehen, als ein kurzer Abriss in dem Film von den außenpolitischen Handlungen der letzten Jahrzehnt der USA von diversen Entmachtungen demokratischer Präsidenten und der anschließenden Einsetzung von Diktatoren, über Massaker an Zivilisten in vielen Ländern der Welt bis hin zur Unterstützung und zum Aufbau von Saddam Hussein und Osama bin Laden bis hin zu den bekannten Folgen aus dieser Unterstützung und dies alles begleitet von dem Song "O what a wonderful world". Ich musste ehrlich gesagt fast heulen.
Moore wandelt den ganzen Film über auf einem schmalen Grad, zwischen satirischer Unterhaltung und ernster Dokumentation, aber ihm gelingt etwas großartiges. Er fällt zu keinem Zeitpunkt von diesem schmalen Grat herunter, es gelingt ihm immer die Balance zu halten und dies macht den Film so großartig, wie er ist.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich ein Kino zu suchen, wo er diesen Film sehen kann, denn dieser Film ist großartig. Besonders gefreut hat mich bei meinem Kinobesuch, dass eine Schulklasse im Kino war, was bei mir erst mal zu einem Schock geführt hat. Denn die Klasse bestand aus der Art von pubertärenden Jugendlichen, die erst einmal während der ganzen Vorschau rumgeblökt hat, ob der wunderlichen Vorschauen, die in einem ihnen gänzlich unbekannten Kino da laufen und ich machte mich schon auf einen schlimmen Kinoabend gefasst, aber nach wenigen Minuten des Films waren die Schüler ruhig (bis auf wenige Ausnahmen) und die gleichen Schüler, die vor dem Film noch vor mir saßen und darüber gemotzt haben, dass sie "sich so einen Scheiß am Abend reinziehen mussten" haben über den Film diskutiert.
Dies ist meiner Ansicht nach ein gutes Beispiel, dass sich das Anschauen des Films lohnt, auch für Leute, die Dokumentarfilmen nicht gerade aufgeschlossen gegenüber stehen. Durch die Art, in der Moore den Film erzählt, bekommen aber auch diese Zuschauer einen sehr leichten Zugang zu diesem Film und das Thema ist eins, dass hoffentlich jeden interessiert.
Michael Moores "Bowling for Columbine" bekommt hochverdiente 10 von 10 möglichen Punkten!
Titel Deutschland: Bowling for Columbine
Originaltitel: Bowling for Columbine
Genre: Dokumentarfilm
USA, Kanada 2002, FSK ohne Altersbeschränkung, Laufzeit: 122 Minuten
Mitwirkende: Michael Moore, Arthur A. Busch, Dick Clark, Chris Rock, Barry Galsser, Charlton Heston, Marilyn Manson, John Nichols, Matt Stone, Seth Collins, Brandon T. Jackson u.a.
Regie: Michael Moore
Produzenten: Charles Bishop, Jim Czarnecki, Michael Donovan, Kathleen Glynn, Michael Moore
Drehbuch: Michael Moore
Musik: Jeff Gibbs
Kamera: Brian Danitz, Michael McDonough
Schnitt: Kurz Engfehr
Ton: James Demer, Francisco La Torre
Hier noch eine Übersicht mit interessanten Links zu diesem Film:
www.bowling-for-columbine.de (Offizielle deutsche Homepage mit einer interessanten Pressedokumentation)
www.bowlingforcolumbine.com (Offizielle englische Homepage mit der Möglichkeit des Anschauens von einigen Teilen des Films, darunter der comicartige Kurzabriss über die Geschichte der USA im Southpark-Stil)
www.michaelmoore.com (Offizielle Homepage von Michael Moore)
© Björn Becher 2002 weiterlesen schließen -
"Trigger happy, trigger happy every day!"

25.11.2002, 23:01 Uhr von
Kool_Kat
Als Filmliebhaber gehe ich häufig ins Kino und nutze hier das reichhaltige Angebot Berlins nach m...Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
"Got an AK-47, well you know it makes me feel alright
Got an Uzi by my pillow, helps me sleep a little better at night
There's no feeling any greater
Than to shoot first and ask questions later
Now I'm trigger happy, trigger happy every day
Well, you can't take my guns away, I got a constitutional right
Yeah, I gotta be ready if the Commies attack us tonight
I'll blow their brains out with my Smith and Wesson
That ought to teach them all a darn good lesson
Now I'm trigger happy, trigger happy every day"
[ 'Weird' Al Yankovich . Trigger happy ]
Horror movies. Rock music. Entertainment television. Eminem. South Park. Heavy Metal. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Immer wieder Marilyn Manson. So die gewissermaßen selbst stets wie aus der Pistole geschossenen Antworten der üblichen Verdächtigen, der „Experten“, kurz nach einem x-beliebigen Amoklauf an einer x-beliebigen Schule, auf die Frage, wer aus jugendlichen Schülern denn nun eigentlich blutrünstige Monster mache. Stakkatohaft werden sie einem durch den Schnitt im durchaus doppeldeutigen Sinne vorgeführt. Die vermeintliche Selbstverständlichkeit ihrer unzähligen Antworten auf diese brennende Frage verliert durch die Montage erheblich an Glaubwürdigkeit, verschwindet in der Beliebigkeit der Aneinanderreihung. Michael Moore, neben Ken Loach wohl der letzte der aufrechten Klassenkämpfer im Kino, hat einen neuen Dokumentarfilm gedreht: Bowling For Columbine.
Wer Michael Moores kontroversen Stil, etwa noch von „Roger And Me“ kennt, der weiß, dass Moore sich mitnichten nur auf rein formal- ästhetische Mittel verlässt, wenn es darum geht, dem eigenen Anliegen mit Nachdruck Gehör zu verschaffen. „Der Morgen des 20. April 1999 sieht nach einem ganz normalen Tag in Amerika aus. Farmer bestellen ihre Felder, Milchmänner liefern Milchflaschen aus, der Präsident lässt Bomben über einem Land abwerfen, dessen Namen wir nicht mal aussprechen können“, mit diesen lakonischen Worten beginnt Moore seinen Film. Kurz nach ihrem Bowlingkurs werden Dylan Klebold und Eric Harris an diesem Tag in der Columbine Highschool/Littleton das bislang größte Massaker in der Geschichte des Schulamoklaufs verüben. Ein trauriger Rekord, der, wie wir wissen, erst dieses Jahr in Erfurt gebrochen wurde.
Moore, selbst seit seiner frühen Kindheit „life long member of the NRA“, wie er sich augenzwinkernd vorstellt, nimmt die Ereignisse von Littleton zum Anlass, tiefer zu forschen. Was hat es mit der im Gegensatz zu anderen Ländern bizarr hohen Mordrate in den USA auf sich? Und warum fanden vergleichbare Schulmassaker bislang hauptsächlich in den USA statt? Als Ausgangspunkt dient hierbei sein eigenes Umfeld, seine Biographie: er stammt aus Flint, Michigan, jene Gegend, die nicht nur einen der beiden Littleton-Attentäter hervorgebracht hat, sondern in deren Umfeld auch Terry Nichols, langjähriger Freund und Komplize, wenn auch freigesprochen, des Oklahoma-Attentäters Timothy McVeigh, und Charlton Heston, das prominente Sprachrohr der National Riffle Association (NRA), aufgewachsen sind. Eine Region also, so ur-amerikanisch wie die großen Gründungserzählungen der USA selbst es sind.
Dort begleitet Moore mit Kamera und seinem trocken-lakonischen Humor Milizen von NRA-Anhängern bei Morgenübungen auf weiter Flur, macht eine Bank ausfindig, die mit einem Gewehr als Prämie für eine Kontoeröffnung neue Kunden zu locken versucht, und besucht eben jenen Terry Nichols, der sich als gesundheitsbewusster Soja-Bauer für eine Tofuproduktion entpuppt. Und mit einer 44er unter dem Kopfkissen zu schlafen pflegt. Der Besitz von Waffen sei sein von der Verfassung gedecktes Recht, von Art und Anzahl der Waffen sei im berühmt-berüchtigten „second amendment“ keine Rede, argumentiert Nichols selbstbewusst beim stolzen Vorführen seiner stattlichen Waffensammlung. Der private Besitz von Nuklearwaffen, so gibt Nichols nach entsprechender Frage von Moore dann doch etwas überrumpelt zu, sei damit vermutlich dennoch bis auf weiteres nicht gedeckt.
Diese für den Zuschauer doch recht amüsanten Episoden machen Moore neugierig. Er begibt sich mit seiner Kamera auf eine Reise quer über den Kontinent, und, parallel dazu, tief hinein in das Wesen der us- amerikanischen Kultur. Auf dieser begegnet er nicht nur Überlebenden diverser Schulmassaker, sondern trifft sich unter anderem auch mit Matt Stone, der seine Erfahrungen in den 80er Jahren an der Columbine High School (!) in den South Park Cartoons verarbeitete. Und eben auch mit dem eingangs vielgeschmähten Marilyn Manson, der überraschenderweise die Kernthese des Films in wenigen Sätzen zusammenfasst: Nicht Armut, Horrorfilme oder geschmacklose Rockshows seien das auslösende Moment für Ereignisse wie das in Littleton, der gesamte kulturelle Text der USA liefe vielmehr auf ein Gefühl der ständigen Bedrohung, dem Drang nach stetiger Neubehauptung hinaus. Eine "Kultur der Angst" vor Eindringlingen und dem eigenen Versagen sei es, die (nicht nur) Jugendliche schnell zur Waffe greifen lasse. Manson leitet dieses Phänomen von der sensationslüsternen Ausrichtung der Nachrichten, der dazwischengeschalteten Werbung und einem erhöhten Schulstress ab. Auf die Frage, was er den jugendlichen Amokläufern zu sagen habe, sollte sich ihm die Möglichkeit dazu bieten, antwortet er, gar nichts, er würde vielmehr zuhören wollen. Und beweist somit, etwas mehr vom Leben verstanden zu haben, als so mancher Experte. Moore formuliert Mansons Statements weiter und widmet sich im weiteren Verlauf einem Exkurs zur sozio-kulturellen Geschichte der USA, durch die sich das Motiv der Angst - zunächst vor den Europäern, dann vor den Ureinwohnern Amerikas, den Hexen, den Sklaven und ihrer späteren Emanzipation, usw. usf. - wie ein roter Faden ziehe. Höhepunkt dieser Zusammenfassung ist schließlich ein hysterisch inszenierter Cartoonfilm-im- Film, der diese Historie grotesk überhöht darstellt, wie überhaupt der gesamte Film aus einem heiter-skurillen 'patchwork' aus 'found footage' diverser Propagandafilme, Nachrichtenschnippsel und eben selbst gedrehtem Material besteht.
Natürlich begegnet Moore auf seiner Reise auch den Verfechtern der üblichen Mythen zur Erklärung der in den USA offensichtlich weitverbreiteten Neigung, vorschnell zur Waffe zu greifen. Neben der eingangs erwähnten Medienkritik rechter und kirchlicher Ideologen, der hohen Armut und den liberalen Waffengesetzen wird hierbei auch die blutige Geschichtstradition der USA in die argumentative Waagschale geworfen. Doch Moore kann eigentlich in keiner These so recht Wahres finden, allzu schnell lassen sie sich in ihrem Kern widerlegen. Armut gäbe es woanders ebenfalls, Jugendliche spielen auf der ganzen Welt Videospiele und hören Marilyn Manson, in Canada befinden sich proportional wesentlich mehr Waffen in privatem Besitz als in den USA, andere Nationalhistorien entpuppen sich als weitaus blutiger. Höhepunkt dieser Dekonstruktion populärer Mythen ist schließlich das Interview mit Charlton Heston in dessen Villa, das sich Moore unter dem Vorwand, selber NRA-member zu sein, quasi erschleicht. In dessen Verlauf konfrontiert er Heston, der es sich selbst nicht nehmen liess, nur wenige Tage nach den tragischen Ereignissen in Littleton eine säbelrasselnde Propaganda-Show für die NRA abzuhalten, mit dem Foto einer Toten eines weiteren Amoklaufes. Beleidigt verlässt Heston das Schlachtfeld.
Für Moore offenbaren sich all diese verkürzenden Erklärungsmuster eher als ideologische Anliegen denn als rationale Deutungen, was er mit der ihm eigenen lakonisch-bissigen Art anschaulich zu vermitteln weiß. So ertappt man sich als Zuschauer mehr als nur einmal dabei, dass man lauthals auflacht über die oft groteske Verblendung mancher Zeitgenossen, nur um sich in ruhigeren Momenten dann doch zu hinterfragen, ob man selbst vielleicht nicht aich einem ideologischen Konstrukt, dem von Michael Moore, aufgesessen ist.
Betrachtet man sich das Gezeigte mal abseits der oft blendenden Satire, so fällt auf, dass vieles, was Moore als 'self-evident' verkaufen möchte, gar nicht so wasserdicht ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Übersetzt man Armut lax mit Arbeitslosigkeit und deutet eine hohe Arbeitslosenrate als einzigen Indikator für Armut, so vernachlässigt man sträflich die oft grundlegend differenten Umstände, unter denen Erwerbslosigkeit stattfinden kann. Und wenn Moore zusammen mit Überlebenden von Littleton in einer Kampagne erzwingt, dass ein nahegelegener K-Mart in Zukunft auf den Verkauf von Munition verzichtet, so ist dies ohne Zweifel ein nobles Anliegen und ein zufriedenstellender Erfolg für die Opfer, doch dass man dem Zustandekommen dieses Siegeszuges derart viel Platz im Film einräumt, lässt doch die Frage aufkommen, ob hier etwa mit dem Betroffenen-Bonus auf dem Schlachtfeld moralischer Debatten unantastbares Land gewonnen werden will. Erfreulicherweise halten sich diese Schwächen jedoch noch passabel im Hintergrund. Ein leicht brackiger Beigeschmack der Manipulation bleibt dennoch, der Menschen, die des kritischen Denkens fähig sind, jedoch nicht weiter stören sollte.
Moore gelingt mit BOWLING FOR COLUMBINE im Diskurs "Gewalt und ihre Ursachen" einer der intelligentesten Beiträge der letzten Jahre. Nicht etwa, weil er mit seinen Thesen eine unwiderlegbare Wahrheit präsentiert, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass er populäre Mythen und ideologisch verkürzende Erklärungsmuster an der Wurzel packt und dort, oft auf unbequeme Art und Weise, nachzufragen wagt, wo der Mainstream nicht selten aus falsch verstandener Pietät zu schweigen pflegt. Schade nur, dass es sich dabei offenbar nicht vermeiden liess, auch jene dankbare Klientel zu bedienen, die sich lediglich einmal mehr ihrer eigenen Ressentiments gegenüber den USA bestätigt sehen wollen. „Die spinnen, die Amis!“ wird man sie wieder allenortes beim Verlassen der Kinos feixend sagen hören, ohne dabei von den Spinnereien vor der eigenen Türe reden zu wollen. Doch dieses Thema wäre eigentlich schon fast wieder einen eigenen Film von Michael Moore wert.
Thomas Groh, 2002
Bowling For Columbine
(Bowling For Columbine)
Dokumentarfilm, Satire
USA 2002, Laufzeit: 120 min.
Regie / Buch: Michael Moore
Kamera: Brian Danitz, Michael McDonough
Schnitt: Kurt Engfehr
Internet Moviedatabase:
http://us.imdb.com/Details?0310793
Offizielle Website:
http://www.bowling-for-columbine.de/
Pressespiegel (USA) bei rottentomatoes.com:
http://www.rottentomatoes.com/m/BowlingforColumbine-1117183/reviews.php weiterlesen schließen -
Annie, get your gun
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
„Im Kino Angst zu bekommen,
ist eine Sache. Manipuliert zu
werden durch Nachrichtensendungen,
Reality-TV oder einen Präsidenten,
der dir sagt, dass es irgendwo einen
federführenden Bösewicht gibt,
der dich jederzeit töten kann, das ist
eine ganz andere Sache“ (Michael Moore).
„Ein bisschen Furcht vor etwas
Bestimmtem ist gut. Sie dämpft die viel
größere Furcht vor etwas Unbestimmten“
(Robert Musil)
„Angst ist die Hauptquelle des
Aberglaubens und eine der
Hauptquellen der Grausamkeit“
(Bertrand Russell)
Zwei Bemerkungen möchte ich zu Michael Moores satirischer Dokumentations-Collage vorausschicken. „Bowling for Columbine“ (1) sollte man keinesfalls zum Anlass nehmen, anti-amerikanische Vorurteile und Klischees zu fördern. Der Film handelt sicherlich in gewissem Sinn von spezifischen US-amerikanischen Problemen, allein die Vereinigten Staaten sind keine außerirdische Insel, auf der alles ganz anders ist als bei uns. Das Bild vom hochgerüsteten amerikanischen Weltpolizisten, der blutrünstig über den Erdball zieht, hat wie jedes Bild zwei Seiten: eine, die in der Realität verwurzelt ist, und eine des Trügerischen, des Feindbildes, beispielsweise einer dem Wahn vermeintlicher Gewaltlosigkeit verfallenen Intelligenz, die sich bei uns längst zum selbst erklärten moralischen Apostel erhoben hat und in gleichem Atemzug doch so äußerst ungern über die Ursachen und Zusammenhänge von Gewalt (übrigens vor allem: struktureller Gewalt) kommuniziert – wie der Teufel, der das Weihwasser fürchtet. Ausdruck dieser Geisteshaltung ist die, insbesondere von Politikern und „Medienexperten“ interessiert vorgebrachte Meinung, Gewalttätigkeit entstehe nicht in sozialen Netzwerken, sondern werde von „gewalttätigen Filmen“ oder / und Video-/Internet-Spielen à la Counterstrike in Bewegung gesetzt – ein bewusstes Ablenkungsmanöver.
Moore selbst führt in seinem Film ein schlagendes Beispiel für den Irrsinn und die Gefährlichkeit dieser Behauptungen an: In Kanada konsumieren die Jugendlichen genauso viel Horrorfilme oder spielen genauso oft Counterstrike & Co. wie in den USA. Die Zahl der Gewaltverbrechen jedoch ist auf eine untrügerische Weise wesentlich niedriger als im Nachbarland. Es bleibt dabei: Gewalt entsteht durch Frustration, Frustration durch Wünsche, wie David Lynch einmal gesagt hat. Wie sich dies konkret abspielt, davon müsste gehandelt werden. Als es noch keine Filme gab, wurden Werke der Literatur für Gewalttaten in die Verantwortung gezogen. Von Goethes Werther wurde z.B. behauptet, er sei für Selbstmorde verantwortlich zu machen. Der erste „Kinomörder“ wurde 1907 „entdeckt“, und es ist erstaunlich, wie heute vor allem das visuelle Medium par excellence, das Fernsehen, an dieser Schraube des behaupteten Zusammenhangs von Kino und Gewalt dreht (2).
Moore – meine zweite Vorbemerkung – ist Satiriker, plakativer Collage-Künstler und realistischer Dokumentarfilmer in einem. Zuweilen schlägt ihm das ins Kreuz, etwa wenn er Armut im wesentlichen auf Arbeitslosigkeit verkürzt und nicht als strukturelles und komplexes Phänomen darstellt, in dem aus struktureller Gewalt physische Gewalt werden kann. Zum Glück für den Betrachter sind die plakativen Statements visueller und verbaler Art in „Bowling for Columbine“ jedoch sparsam gesät, so dass der Film insgesamt darunter nicht leidet.
Ausgangspunkt für den hartnäckigen, im positiven Sinn skrupellosen Michael Moore ist die Frage, wie es zu der mit Abstand weltweit höchsten Todesrate von mehr als 10.000 „gun deaths“ pro Jahr in den USA kommt (wobei die Zahl der Gewaltverbrechen insgesamt in den Vereinigten Staaten seit einigen Jahren rückläufig ist!). Moore hat vordergründig kein Konzept. Er rennt einfach los, nach Littleton, an die Columbine High School, an der dieses schreckliche Massaker stattfand, an die kanadische Grenze, nach Toronto, zu Charlton Heston, prominentes Mitglied und Vorsitzender der National Rifle Association, die das Recht jedes Amerikaners auf Besitz, Tragen, Laden und Einsatz von Waffen aller Art propagiert und sich nicht scheute, kurz nach dem Columbine-Massaker in der Nähe eine waffenklirrende und Feindbild-orientierte Versammlung abzuhalten, in seine Heimat, nach Flint, in der ein sechsjähriger Junge ein gleichaltriges Mädchen erschossen hatte, zum Bruder des Oklahoma-City-Attentäters Terry Nichols, James Nichols. Moore interviewt Leute aus Littleton, u.a. einen Mann, der sich über diese schreckliche, alles überwältigende, erschreckende Normalität der Leute beklagt, die Kinder von Beginn an in ein bestimmtes Fahrwasser des Lebens führen; er spricht mit Goth-Rocker Marilyn Manson, der bei stockkonservativen Amerikanern für das Blutbad in Columbine mit verantwortlich gemacht wurde, usw.
Moore ist auf Spurensuche. Er klopft Argumente ab. Ist es allein die erschreckende Zahl der Waffen, die Jugendliche von früh auf die Möglichkeit eröffnen, selbst einmal damit ihrer Wut Ausdruck zu verleihen? 250 Millionen Waffen lagern in amerikanischen Privathaushalten. Munition ist in Supermärkten so gut wie frei verkäuflich, bei K-Mart zum Beispiel.
Ist es die amerikanische Geschichte, die eine Blutspur hinter sich her zieht – von der Ausrottung der Indianer, der Versklavung der Schwarzen, über die Kriege der vergangenen Jahrzehnte bis hin zur Bush-Politik der Weltpolizei-Macht? Moore zeigt einen rasant gedrehten Comic, in dem dies satirisch dargestellt wird. Sind es die katastrophengeilen Medien, die Tag für Tag über Mord, Totschlag, Gewaltverbrechen anderer Art Angst und Schrecken verbreiten, der mit der Realität wenig zu tun hat?
„Ich hätte diesen Film auch
schon vor zehn Jahren machen können,
denn es geht nur vordergründig um
Columbine oder etwa um Waffen.
Amerika war vor zehn Jahren genau
so wie heute. Der Film handelt von
unserer Kultur der Angst und wie
unsere Angst uns zu Gewaltakten
auf häuslicher und internationalerEbene führt“
(Michael Moore).
Bei der Spurensuche Moores kann man nie sicher sein, ob das, was er zeigt, nun wahr oder gestellt ist. Wenn er in Kanada von einem Haus zum anderen geht und alle Türen sind offen – wurde das vorher abgesprochen? Oder haben die Kanadier deutlich weniger Angst vor Verbrechen als ihre amerikanischen Nachbarn? Moore eröffnet bei einer Bank ein Konto. Die Bank verspricht jedem, der das tut, die kostenlose Übergabe einer Waffe. Gestellt oder echt?
Es ist dieses Spiel zwischen Sicherheit und Angst, Realität und Phantasie, brutalen Fakten und satirischer Überspitzung, das die Spurensuche Moores erschreckend und belustigend zugleich werden lässt. Moore findet keine unumstößlichen Antworten auf seine zentrale Frage, aber einen Ausgangspunkt für eine Antwort: die unglaubliche und von den Medien unglaublich geförderte Angst und das damit korrespondierende übertriebene Sicherheitsbedürfnis vieler Amerikaner, Opfer von Gewalttaten zu werden. Für beides gibt es Spuren der Erklärung in der amerikanischen Geschichte wie in der politischen und sozialen Gegenwart.
Gerade nach dem Terroranschlag des 11. September 2001 ist Moore eine mutige Collage gelungen, in der er genau diesen Zusammenhang von (panischer) Angst und (extremem) Sicherheitsbedürfnis im wesentlichen exzellent verfolgt. Dabei ist Moore nicht etwa ein Revolutionär, ein anti-amerikanischer Amerikaner, sondern vielleicht der bissigste Sozialkritiker und Patriot in einer Person – immerhin auch Mitglied der waffenstarrenden NRA. Gerade weil er amerikanische Geschichte nicht in einem verwissenschaftlichtem Trockenkurs, sondern in einem vielleicht zwei, drei Minuten dauernden Comic auf satirische Art nahe bringt, ist seine Aussage überzeugend – überzeugend nicht als letztgültige Antwort, sondern als Katalysator, um über die Momente dieser Geschichte nachzudenken, die Angst, Paranoia und Sicherheitswahn beflügeln. Die Geschichte der amerikanischen Siedler ist eben auch eine des Gefühls der permanenten Gefahrenlage. Die Ausrottung der Indianer verkehrt sich so in einem Akt der Herstellung öffentlichen Bewusstseins zur chronischen Angstpsychose von einer stets allgegenwärtigen Bedrohungssituation. (3)
Hinzu kommt der Rassismus gegenüber den aus Afrika „importierten“ Sklaven, die Entstehung des Ku Klux Clan und der NRA, fast zur gleichen Zeit, – und damit eine neue Bedrohungssituation. Es ist bezeichnend, wie sich auch hier das Täter-Opfer-Verhältnis ins Gegenteil verkehrt. Bis in die heutige Medienlandschaft hinein hält sich – auch das zeigt Moore – das ideologisch gefärbte und verkehrte Bild von einer schwarzen kriminellen Bevölkerung vor allem in den Großstädten, die die Weißen zwang in die Vorstädte auszuweichen, um dort – abgeschottet und verschlossen in ihren Einfamilienhäusern und mit der geladenen Waffe unter dem Kopfkissen – der Gefahr harren und trotzen.
Last but not least führt Moore die amerikanische Außenpolitik der „absoluten“ Stärke und der „absoluten“ Sicherheit vor, eine Politik, die – man kann schon sagen: maßlos – den Schmetterlingsschlag in irgendeinem Zipfel der Welt zu einer Bedrohung der eigenen Sicherheit deklariert (4).
Man mag an einzelnen Aussagen Moores zweifeln, seine politische Grundhaltung nicht teilen. Eines jedoch ist sicher: „Bowling for Columbine“ ist eine zweistündige Achterbahnfahrt, die zum Nachdenken genug Anlass gibt und zudem – angesichts solcher Ereignisse wie in Erfurt – weder eine inneramerikanische Angelegenheit ist, noch zu anti-amerikanischen Ressentiments Anlass gibt. Es ist immer einfach und letztlich folgenlos zu sagen: „Die Amis, die spinnen.“ Warum sie „spinnen“ und warum auch bei uns daheim viele „spinnen“ – das sind die Fragen, die einen bewegen sollten. Moores Film ist für alle, die das tun wollen, ein absolutes Muss.
Wertung: 10 von 10 Punkten.
(1) Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, dass die beiden Jugendlichen Dylan Klebold und Eric Harris wenige Stunden vor dem von ihnen verübten Massaker an der Columbine High School, bei dem zwölf Schüler und ein Lehrer getötet und viele andere schwer verletzt wurden, ihren Bowling-Kurs besuchten.
(2) Ich empfehle in diesem Zusammenhang einen Artikel von Thorsten Lorenz in der „Frankfurter Rundschau“, „Wenn das Kino töten könnte. Medien-Mörder: Über den Ursprung eines pädagogischen Wahns“ (FR vom 2.11.2002):
(3) In dem Zeichentrickfilm heißt es: „Das Erste, das man als Kind über die amerikanische Geschichte lernt, ist: ,Die Pilger kamen nach Amerika, weil sie Angst vor Verfolgung hatten.‘ Sie hatten Angst. Und was geschah dann? Die Pilger kamen, voller Angst, begegneten den Indianern und hatten noch mehr Angst vor ihnen, also brachten sie sie um. Dann bekamen sie Angst voreinander, begannen Hexen zu sehen und verbrannten sie; dann gewannen sie die Revolution, aber sie hatten Angst, dass die Briten zurückkämen. Also verfasst jemand das Second Amendment (beinhaltet das per Verfassung verbriefte Recht auf das Tragen von Waffen), das sagt: ‘Lasst uns unsere Waffen behalten, weil die Engländer zurückkommen könnten.’ Was passiert? Die Briten kommen zurück! Was ist das Schlimmste, was einem Paranoiker zustoßen kann? Wenn seine Ängste wahr werden!“ „Mittlerweile sagen alle: ‘Verdammt gut, dass wir die Waffen behalten haben!’ Whoaaaa, Second Amendment, gute Idee!“
http://www.fr-aktuell.de/archiv/fr30t/h120021101092.htm
(4) Vgl Moores Buch „Stupid White Men. Eine Abrechnung mit dem Amerika unter George W. Bush“, 329 Seiten (Piper-Verlag, € 12,-, seit dem 1.10.2002 auf in deutscher Übersetzung auf dem Markt), sowie die unter http://www.bowling-for-columbine.de als PDF-Datei erhältliche Pressedokumentation (25 Seiten).
Bowling for Columbine
(Bowling for Columbine)
USA, Kanada 2002, 122 Minuten
Regie: Michael Moore
Drehbuch: Michael Moore
Musik: Jeff Gibbs
Kamera: Brian Danitz, Michael McDonough
Schnitt: Kurz Engfehr
Spezialeffekte: –
Mitwirkende: Michael Moore, Arthur A. Busch, Dick Clark, Barry Galsser, Charlton Heston, Marilyn Manson, John Nichols, Matt Stone u.a.
Offizielle Homepage: http://www.bowling-for-columbine.de
Internet Movie Database: http://us.imdb.com/Title?0310793
Weitere Filmkritik(en):
„Chicago Sun-Times“ (Roger Ebert):
http://www.suntimes.com/ebert/ebert_reviews/2002/10/101803.html
„Movie Reviews“ (James Berardinelli):
http://movie-reviews.colossus.net/movies/b/bowling_columbine.html
© Ulrich Behrens 2002 für
www.ciao.com
www.yopi.de weiterlesen schließen
Informationen
Die Erfahrungsberichte in den einzelnen Kategorien stellen keine Meinungsäußerung der Yopi GmbH dar, sondern geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder. Beachten Sie weiter, dass bei Medikamenten außerdem gilt: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
¹ Alle Preisangaben inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versand. Zwischenzeitl. Änderung der Preise, Lieferzeiten & Lieferkosten sind in Einzelfällen möglich. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Bewerten / Kommentar schreiben