Pro:
Schreibstil, authentische historische Verhältnisse, Handlungsverlauf, Spannung, Aufbau und Entwicklung der Figuren, Stimmigkeit von Handlung, Personen und Fakten
Kontra:
zu lange Vorgeschichte, bis es endlich zum eigentlichen Thema kommt; wichtigster Teil wird nur grob überflogen; zu wenig wiedererkennbare Details bzgl. Landschaft und Orte; zu wenig Hintergrund zum Jakobsweg an sich
Empfehlung:
Ja
Meine Motivation, dieses Buch gelesen zu haben, dürfte eigentlich klar sein. Ich wollte eben wissen, wie es in früheren Zeiten wohl gewesen sein muss, auf dem Jakobsweg zu pilgern, welche Schwierigkeiten es speziell damals gab und wie die Pilger dann dennoch versucht haben, diese zu meistern (ich denke, gerade im Mittelalter musste man sicherlich einen sehr starken Glauben haben, dass man auch ankommt! vor allem in Kriegszeiten...), aber auch, wie der Jakobsweg damals aussah und wie er sich eventuell seither verändert hat.
Ob bzw. inwieweit dieser zugegeben hohe Anspruch (der wohl auch daraus resultieren mag, dass ich das Buch aus einer bestimmten Perspektive, d.h. vor einem gewissen Erfahrungshorizont, gelesen habe) erfüllt wurde, erfahrt Ihr in diesem Bericht.
== Wie kam ich nun zu dem Buch? ==
Ich habe meine im Knaur Verlag erschienene gebundene Ausgabe beim Amazon Marketplace gekauft, kann mich aber nicht mehr genau an den Preis erinnern, den ich bezahlt habe. Es war jedoch auf keinen Fall zu viel. Zum Zeitpunkt, zu dem ich diesen Bericht schreibe, ist diese Ausgabe dort gebraucht ab 2,55 € zu haben. Bei mir war es glaube ich ein wenig mehr – aber nicht viel.
== Woran erkennt man es auf den ersten Blick? ==
Es zeichnet sich durch ein grün dominiertes Cover aus, auf dem das Porträt einer in ein weites Gewand bzw. Kleid gekleideten Frau zu sehen ist. Das Oberteil ist orange und am Dekolleté in einem Grauton gehalten, während das untere Teil ebenso wie der Hintergrund des Buchrückens und der Rückseite Dunkelgrün ist. Sie ist in einer sitzenden, nachdenklichen Position abgebildet und hält ein in helles Leder gebundenes Buch in der Hand. Ihr Gesicht sieht man nicht, da es sich oberhalb des Buchrandes befinden würde.
Passt das Motiv? Nun, zum Thema mag es ja gut passen. Dennoch merkt man sofort, dass es sich (obwohl das mutmaßliche Alter der abgebildeten jungen Frau durchaus mit dessen Alter übereinstimmen könnte) nicht um eine authentische Darstellung DER Pilgerin und Protagonistin Tilla Willinger handeln kann. Das finde ich persönlich nicht schlimm – denn bei der Auswahl von Bildern für ein Buchcover ist es wohl nicht möglich, auf sämtliche Details zu achten – ich vermute, sonst würden sie heute noch nach einem hundertprozentig passenden Motiv suchen, und das Buch wäre nie veröffentlicht worden. ;-) Nein, an so einer Kleinigkeit darf es nicht scheitern. Denn insgesamt trifft es schon den Kern der Sache sowie die Stimmung.
== Worum geht es hier? ==
Tremmlingen (eine fiktive Stadt in der Nähe von Ulm) in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts: Der alte Kaufmann Willinger – Tillas Vater – ist schwer krank. Zu Beginn des Romans sind Tilla, die ihn pflegt, sein Arzt und der Bürgermeister Laux (auch Willinger ist Ratsmitglied, so wie es zu jener Zeit bei bedeutenden Kaufleuten nicht unüblich war) an seinem Krankenbett versammelt. Der Arzt verordnet ihm eine eklig schmeckende Kräutermedizin, die schon hohen Persönlichkeiten geholfen hat. Tatsächlich scheint er sich nach dessen Einnahme etwas zu erholen...
Dennoch macht er sich viele Gedanken über das „Danach“, wie es nach seinem Tod (der zweifelllos nicht mehr allzu fern ist, er ist schließlich nicht mehr jung und auch nicht völlig geheilt) weitergehen wird. Er beschließt, sein Testament umzuschreiben; in der neuen Version will er als letzten Willen unter anderem festhalten, dass Tilla Damian Laux (dem Sohn des Bürgermeisters) heiraten soll, wie es schon vorher abgesprochen worden war, und dass ferner Ottfried Willinger, Tillas Bruder, für ihn und sein Seelenheil nach Santiago pilgern soll, um dort das Herz seines Vaters zu begraben. Im Falle, dass Ottfried nicht gewillt ist, seinem Vater diesen letzten Wunsch zu erfüllen, verspricht Tilla, dass sie stattdessen mit dem Herzen ihres Vaters nach Santiago pilgern wird.
Der alte Willinger kann jedoch nicht wissen, dass sein Sohn völlig anderes im Sinn hat. Dieser strebt nur nach Macht und Geld. Um dieses zu erlangen, hat er sich mit dem Erzfeind seines Vaters, Veit Gürtler, verbündet. Dieser, verbunden mit der Tatsache, dass er es nicht erwarten kann, das Erbe seines Vaters anzutreten, bringt ihn schließlich dazu, ihn umzubringen. Bzw. die letztliche Ausführung übernimmt Gürtler – doch das tut auch nichts zur Sache.
Zuvor hat Ottfried noch erfolgreich verhindert, dass die neue Version des Testamentes beglaubigt wurde – er hat die Mitschrift einfach nicht wie vom Vater vorgesehen bei dem entsprechenden Verantwortlichen zur Beglaubigung vorgelegt. Diese neue Version ist also niemandem bekannt, so dass Ottfried seine eigennützigen Pläne (bei denen er freilich von Veit Gürtler maßgeblich beeinflusst wird) unbehelligt in die Tat umsetzen kann.
Um nämlich ihr Bündnis zu verfestigen, aber auch sich finanzielle und politische Vorteile durch diese Verknüpfung beider Handelshäuser zu sichern, heiraten sie sich gegenseitig in die jeweils andere Familie ein. Das heißt Tilla wird mit Gürtler (der schon seine vorige Frau... nun ja... überaus schlecht behandelt hat!) zwangsverheiratet, während Ottfried Radegund erhält, die noch ein halbes Kind ist.
Wie zu erwarten ist die Hochzeitsnacht für Tilla die Hölle. Fast könnte sie froh sein, als sie am nächsten Morgen bemerkt, dass ihr gegen ihren Willen überstürzt und noch in der Trauerzeit frisch angetraute Gatte tot im Bett liegt. Er hat nämlich irrtümlich von dem vergifteten Wein getrunken, den die Willinger-Magd und Ottfrieds eifersüchtige Mätresse Ilga eigentlich für dessen Braut vorgesehen hatte (sie macht sich Hoffnungen, so an ihre Stelle treten zu können – obwohl Ottfried so etwas nicht im Sinn hat). Natürlich glauben alle, Gürtler wäre eines natürlichen Todes gestorben, durch einen Herzinfarkt o.ä.
Nach seinem Tod wird es jedoch für Tilla keineswegs besser. War die Gürtler.Familie bereits zuvor ihr nicht gerade freundlich gesinnt, zeigen sie ihr nun immer deutlicher und auf psychisch schmerzhafte Weise ihre Feindseligkeit. Wohl auch, weil sie befürchten, Tilla könnte ihnen als Witwe einen Teil des Erbes wegnehmen. Sie versuchen, sie durch ihr ablehnendes, gehässiges Verhalten und durch Isolierung in den Wahnsinn zu treiben und setzen vorsetzlich solche Gerüchte in die Welt, die (bei nüchterner Betrachtung und für Menschen, die Tilla näher kennen, völlig unberechtigte) Zweifel an ihrem Geisteszustand sähen.
So ausweglos ihre Lage scheint – irgendwie entkommt sie ihr doch. Heimlich verlässt sie das verhasste Haus ihrer Schwiegerfamilie, schleicht sich des Nachts verkleidet durch einen Hintereingang in ihr Elternhaus, in dem nun ihr Bruder regiert – und stiehlt den Behälter mit dem Herzen ihres Vaters sowie die Schatulle, in dem sich ihr Ehevertrag und das unbeglaubigte Testament ihres Vaters befinden; aber auch ein Vertrag, in dem sich Ottfried, Gürtler und viele andere, die letzterer für sich hat gewinnen können, sich praktisch gegen den jetzigen Bürgermeister von Tremmlingen verschwören. Hinter dieser Verschörung steckt letztlich der bayerische Herzog Stephan mit seinen Leuten; dieser hat nämlich ein Interesse daran, die bisher freie Stadt einzunehmen.
Nachdem Tilla die Schatulle im Häuschen ihrer ehemaligen Kinderfrau Elsa versteckt und sich von Elsa verabschiedet hat, zieht sie los. Sie begibt sich zunächst nach Ulm, wo sich die meisten Pilgergruppen in der Gegend versammeln, denn sie hofft, sich dort einer Pilgergruppe anschließen zu können (zu jener Zeit war es nämlich besonders riskant, allein zu reisen). Ihre Reise beginnt sie als Mann verkleidet, d.h. in langen Gewändern, in denen ihr Geschlecht und ihre Identität nicht auf dem ersten Blick ersichtlich sind. Denn sie befürchtet, ihr Bruder könnte jemanden hinter ihr herschicken, um sie zurückzuholen – also muss sie unerkannt bleiben.
In Ulm wird sie Zeugin, wie ein Schlitzohr versucht, einem Pilger seinen Geldbeutel zu stehlen – und schreitet erfolgreich ein. So wird sie mit dem Goldschmied Ambros bekannt. Kurz darauf schließen sich die beiden der Pilgergruppe des Priesters Vater Thomas an – nun besteht die Gruppe insgesamt aus 12 Personen, der Zahl der Apostel, worauf der Geistliche aus symbolischen Gründen großen Wert legt.
In dieser Konstellation machen sie sich auf den Weg. Sie, das sind – neben Tilla, Ambros und Vater Thomas – unter anderem Hedwig (die als eine der ersten dahinterkommt, dass „Otto“ in Wahrheit Tilla ist), die Schwestern Anna und Renata, Peter, Sepp (der zur Buße pilgert, weil er in der Vergangenheit und in betrunkenem Zustand seine Frau des öfteren geschlagen hat – in ihm vollzieht sich im Verlauf des Wegs wohl eine der eindrucksvollsten, weil unvorhergesehenen, Wandlungen zum Positiven), und der etwas einfältig erscheinende aber eigentlich sympathische Manfred. Mit der Zeit lernen sich alle gegenseitig kennen und – mal mehr, mal zunächst weniger – schätzen.
Unterwegs erleben sie so manches Abenteuer, werden auch Zeugen von einigen historischen Ereignissen, und haben die eine oder andere Schwierigkeit zu meistern und Entscheidung zu treffen. Ein paar Mal legen sie aufgrund der Umstände oder anderer Erwägungen auch Umwege ein.
Irgendwo in der Schweiz werden sie Zeuge einer kleineren Streitigkeit zwischen Edelleuten und lernen so den Habsburger (Österreicher!) Rudolph von Starrheim kennen, der sich ihnen anschließt.
Tillas Befürchtung, verfolgt zu werden, bewahrheitet sich. Beim ersten Mal, in einem Kloster, erkennen sie die beiden, die im Auftrag ihres Bruders geschickt wurden, jedoch nicht. Außerdem wurde noch jemand anderes auf sie angesetzt – um sie zu beschützen: Bürgermeister Laux hat seinen zweiten Sohn Sebastian aus Sorge um Tilla nach ihr geschickt. Als Sebastian sie eingeholt hat, wird er bald Teil der Gruppe – zunächst muss er in einigem Abstand hinter ihnen herwandern, doch dann wird er ganz aufgenommen.
Es nervt Sebastian natürlich sehr, als ein offensichtlich schwuler pilgernder Geistlicher heftet sich an seine Fersen heftet. Im späteren Verlauf wird jedoch auch Bruder Carolus Teil der Gruppe.
In Südfrankreich geraten sie erstmalig mitten in einen Krieg – den zwischen den Franzosen und den Engländern – dem zwei der Pilger zum Opfer fallen und wo ein paar weitere verletzt werden sowie Anna von Soldaten vergewaltigt wird. Nachdem die verbleibenden Pilger wieder zusammengekommen, sich ggf. notdürftig verarztet haben und wieder etwas zu Kräften gekommen sind, setzen sie ihren Weg fort. Zeitweilig übernimmt Tilla, die auf dem Weg insgesamt richtig aufblüht und so manches Mal große Stärke zeigt, wo andere eventuell kurz vor dem Aufgeben sind, vorübergehend die Führung, weil Vater Thomas von den vorangegangenen tragischen Ereignissen sehr mitgenommen ist und sich wohl auch große Vorwürfe macht. Tilla ist es auch, die es veranlasst, dass sie die beiden toten Kameraden so würdevoll, wie es unter den gegebenen Umständen eben geht, begraben.
Eine weitere Schwierigkeit (neben der körperlichen Anstrengung bei recht karger Nahrung), der sie sich stellen müssen, sind die Flüsse, die sich nun einmal nur mit einer Fähre überqueren lassen. Die Fährleute sind aber nur selten bereit, Pilger kostenlos überzusetzen. Und beim Entgelt erweisen sie sich als sehr habgierig. Wer mehr Geld hat oder eine höher gestellte Persönlichkeit ist, wird bevorzugt – wer zu wenig gibt, oder überhaupt kein Geld hat, der muss halt schwimmen ;-) – oder sehen, wie er sonstwie herüberkommt. Tillas Gefährten haben es zum Glück immer geschafft – viele andere Pilger hingegen mussten bis auf weiteres diesseits des jeweiligen Flusses bleiben.
Nachdem sie das weiter oben erwähnte Kriegsgebiet verlassen hatten, wurden sie in einem Tal von einer Frau namens Olivia und ihren Dorfbewohnern gastfreundlich empfangen. Dieses Dorf ist etwas Besonderes: Hier ist eine Frau Priesterin, und hier wird noch der alte Glaube gelebt, der sich teilweise mit dem Christentum vermischt hat. Allerdings ist dieser Glaube auch vom Aussterben bedroht, denn es gibt keine Nachfolgerin, die die Rolle der Priesterin übernehmen könnte, wenn diese einmal nicht mehr da ist.
Das Schicksal will es, dass sie einen weiteren Umweg in Kauf nehmen. So verschlägt es sie nach Orthez, dem Sitz eines hohen Adligen, dem Mündel der jungen Blanche. Dort weilen zu dem Zeitpunkt auch die intrigante Felicia de la Caune, die eigentlich die Frau von Hugues Saltilieu hätte werden sollen und eine mindestens so schwarze Seele hat wie er. Da sie ihn unter gar keinen Umständen heiraten will, lässt sie ihn ermorden. Auch Saltilieus Vetter Aymer, der das genaue Gegenteil von Hugues ist und ein weitaus angenehmerer Zeitgenosse, weilt auf der Burg. Auch dieser ist Tilla schon bekannt – denn dessen Vetter Hugues hatte sie und ihre Freunde zuvor einmal auf seiner Burg gefangengesetzt zur Strafe dafür, dass sie Felicia auf deren Drängen beim Fliehen geholfen hatten (wobei sich die Frage stellt, ob sie das auch dann getan hätten, wenn sie gewusst hätten, was für eine Person das ist). Wie sie dann freikamen, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten – ein bisschen Geheimnis muss ja als Leseanreiz bleiben. ;-)
Sie überqueren die Pyrenäen, finden sich in Roncesvalles wieder (wo sie eine Kapelle besuchen, die auf dem Grab eines gewissen Roland erbaut wurde), kommen irgendwann nach Pamplona und erreichen dann Puenta la Reina. Dort halten sie sich eine ganze Weile (einige Monate!) im Kloster auf, da in Kastilien wiederum Krieg herrscht und sie auf die Rückkehr von Starrheim und Sebastian warten, die sich den französischen Rittern angeschlossen haben. Etwas zittern sie, als sie von der anderen Seite eines Tages die Engländer (die Gegner der Franzosen und derer Verbündeter) in Richtung mutmaßlichem Kriegsschauplatz ziehen sehen – auch wenn diese ziemlich spärlich ausgerüstet sind. Dafür ist ihre Zahl nicht zu verachten.
Doch glücklicherweise gewinnen die Franzosen, sie sehen Starrheim und Sebastian lebend wieder und brechen etwas überstürzt – im Schutze der französischen Eskorte weiter. Allerdings zu Pferd.
So treffen sie schneller in Santiago ein, als sie es zu Fuß (wenn überhaupt – man bedenke die Verhältnisse!) erreicht hätten. Aber gut – durch all die vorangegangenen Geschehnisse haben sie ja schon viel Zeit verloren. Schade nur, dass dadurch in der Story eine nicht unwesentliche Strecke von etwa 700 km quasi überflogen wird!
Doch damit wäre ich schon beim nächsten Punkt: Meiner Meinung.
== Wie stehe ich zu dem Buch? ==
Lobend erwähnen möchte ich, dass die Autorin sich große Mühe gegeben hat, sowohl die Lebens- und politischen Verhältnisse zu jener Zeit sowohl glaubhaft als auch auf unterhaltsame Weise wiederzugeben. Die Figuren sind keineswegs flach, sondern jede hat ihre eigene Geschichte und Persönlichkeit, die sich im Verlauf des Romans auch weiterentwickelt. Sie versteht es, den Spannungsbogen immer wieder neu zu beleben, auch durch überraschende Wendungen. Die Sprache ist anschaulich und leicht verständlich – sollte einem ein fremdartiger mittelalterlicher Begriff begegnen, kann man entweder hinten im Glossar nachschauen, oder aber er erklärt sich von selbst. Erzähltext und wörtliche Rede wechseln einander ab und ergänzen sich auf harmonische Weise. Während der Erzähltext Handlungen, Geschehnisse und in Maßen die Umgebung etc. beschreibt, wird die Geschichte durch die Dialoge noch lebendiger. Ich empfand diesen Stil als sehr ausgewogen und hatte zu keiner Zeit das Gefühl, die Story würde nicht vorankommen. Zu diesem Eindruck hat sicherlich auch die Tatsache beigetragen, dass hier viele Handlungsdetails eingebracht wurden – ohne zu überfordern oder sich wirklich zu überstürzen.
So viel zu den Pro`s.
Allerdings habe ich auch einiges zu kritisieren.
Der größte Hammer ist sicherlich der, dass – während die erste Hälfte bis einschließlich Frankreich sehr detailreich erzählt wird – praktisch die ganze Strecke zwischen Puenta la Reina und Santiago stark gerafft, bzw. fast ganz unterschlagen wird! Dabei wäre es meiner Ansicht nach die wichtigste Strecke gewesen. Nun gut, es stellt sich die Frage, inwieweit es zu jener Zeit möglich war, diese Strecke mitten im Krieg zu Fuß zu passieren. Trotzdem hätte ich mir hier eine detailiertere Erzählung gewünscht – statt sich so lange mit der ersten Hälfte aufzuhalten. Offenbar wollte die Autorin schnell zum Ende kommen – nachdem sie festgestellt hatte, dass sie sich viel zu sehr mit den vorigen Geschehnissen beschäftigt hatte. Wie gesagt – die detailreiche Erzählung beeinträchtigt die Handlung keineswegs negativ (mir war zu keiner Zeit langweilig beim Lesen, noch wurde meine Geduld auf eine Probe gestellt – und das, obwohl allein die Vorgeschichte sich über mehr als 100 Seiten zieht). Jedoch denke ich, man hätte die erste Hälfte des Weges straffen können (selbst wenn das bedeutet hätte, ein paar Ereignisse wegzulassen) – um wenigstens noch die besagte Strecke, die so gut wie übersprungen wurde, näher zu beschreiben. Klar: Wenn sie die Geschichte so fortgesetzt hätte wie bisher. wäre das Buch vermutlich doppelt so dick geworden. Eben deshalb wäre es wichtig gewesen, die Prioritäten entsprechend zu setzen. Schließlich sollte in einem Roman über den Jakobsweg meiner Ansicht nach dieser die Hauptrolle spielen bzw. sich auf diesem das Hauptgeschehen abspielen. Versteht mich nicht falsch: Die Vorgeschichte, aber auch die kurzen Anrisse zu den jeweiligen Motivationen der Nebenfiguren, haben ihre Berechtigung. Auch einige Ausführungen zu den damaligen Verhältnissen – zumal natürlich, wenn sie direkte Auswirkungen auf das Pilgern haben! – tragen dazu bei, dass man sich besser vorstellen kann, wie es damals gewesen sein muss. Aber sind denn sämtliche Nebengeschehnisse, auch solche, die vom eigentlichen Weg u.U. wegführen, notwendig? Für einen normalen historischen Roman mag dies ja sehr interessant sein. Hier aber hätte ich an ein paar Stellen gerne gesagt: „Thema verfehlt“.
So detailreich die Handlung beschrieben wird – so bescheiden sind etwa Landschaftsbeschreibungen, Beschreibungen der Orte am Jakobsweg an sich. Hier beschränkt sie sich auf das Wesentliche. Natürlich würden ellenlange Beschreibungen den Handlungsfluss deutlich bremsen (das ist es nicht, was ich will). Aber ist es denn zu viel verlangt, dass ich die Möglichkeit haben will, mir als Leserin ein Bild von der Umgebung machen will – so, als würde ich es vor mir sehen? Dies war hier nicht immer der Fall. Und was den spanischen Teil betrifft (soweit er beschrieben wurde): Während die Landschaft um Roncesvalles ziemlich authentisch beschrieben wurde, gab es von da im weiteren Verlauf nichts, was für mich Wiedererkennungswert gehabt hätte (Puenta la Reina wurde an sich um Buch ja nicht beschrieben, sondern nur ein Kloster erwähnt, das damals dort gestanden haben muss). Ausnahme: Die Kathedrale von Santiago. Und auch bei der Bucht vor Finisterre, in der Tillas Gruppe gebadet hat, kann ich mir vorstellen, welche gemeint ist (es gibt nur eine, die man als Bucht bezeichnen kann) – aber zu der geht es steil bergab, so dass man in dem Wald, von dem diese umgeben ist, nicht so einfach verschwinden kann... Aber diese Bucht befindet sich ein paar Kilometer VOR dem eigentlichen Ende des Camino – DIESES Ende ist sehr felsig. Diese Einzelheiten bringen mich zu der Schlussfolgerung, dass Frau Lorentz – so gut sie die historischen Fakten und Umstände auch recherchiert hat – sich nicht vor Ort kundig gemacht hat. Wahrscheinlich ist das der zweite Grund dafür, dass sie den Roman – nachdem sie so lange an der ersten Hälfte geschrieben hat (eine Strecke, die die meisten heutigen Pilger ohnehin nicht kennen, da sie erst vor den Pyrenäen losgehen) – möglichst schnell fertigstellen wollte. Sehr schade, dass darunter der Hauptteil der Pilgerreise, um die es gehen sollte, leiden musste! Glimpflich ausgedrückt.
Dann ist mir noch eine Ungereimtheit aufgefallen, die vielen sicherlich entgangen wäre: Jedenfalls finde ich es etwas seltsam, dass Tilla auf einmal einen baskischen (!) Mönch fließend versteht, während sie zuvor erhebliche Probleme hatte, die Franzosen inklusive derer Dialekte zu verstehen (anfangs muss sie sich sogar alles übersetzen lassen)? Warum sollte ihr das Verständnis des Spanischen leichter fallen als das des Französischen? Zwar spricht sie nicht viel bei dem Gespräch mit dem Mönch, sondern antwortet bzw. kommentiert nur kurz. Seltsam ist es trotzdem – zumal ihre Sprachkenntnisse kurze Zeit später wieder bescheiden werden.
So viel zu meiner persönlichen Einschätzung.
Bevor ich diesen Bericht abschließe, möchte ich noch ein paar Worte zur Autorin selbst verlieren.
== Wer ist Iny Lorentz? ==
Sie ist geborene Kölnerin, wohnt aber aktuell in München, wo sie hauptberuflich als Programmiererin bei einer Versicherung tätig ist.
Schreiben tut sie seit den Achziger Jahren, zunächst in Form von Kurzgeschichten, später historische Romane, durch die sie auch berühmt wurde.
Weitere Werke (ohne Reihenfolge wiedergegeben):
Die Wanderhure
Das Vermächtnis der Wanderhure
Die Kastellanin
Die Goldhändlerin
Die Kastratin
u.a.
== Die wichtigsten Fakten im Überblick ==
Iny Lorentz: Die Pilgerin
Gebundene Ausgabe
Verlag: Knaur
Erscheinungsjahr: 2007
688 Seiten (für den Roman selbst - insgesamt 702)
Preis: (neu) 16,90 €; (gebraucht) ab 2,50 € bei Amazon
ISBN: 978-3-426-66249-6
Extras: Karte am Anfang, Glossar und historischer Rückblick zum Schluss
== Fazit ==
Auch wenn es mein erstes Buch von dieser Autorin war, ahne ich, dass es nicht gerade zu ihren am besten gelungenen gehört (d.h. es muss bessere geben – denn Erzählpotential hat sie, gerade in diesem Genre!).
Auf unterhaltsame Weise wird hier – unter Berücksichtigung historischer Fakten, aber auch mit vielen Details, die die Verhältnisse dieser Zeit glaubwürdig wiedergeben – die Geschichte der Protagonistin Tilla erzählt. Nicht nur diese, sondern auch die Nebenfiguren wurden gut herausgearbeitet und entwickeln sich im Verlauf der Handlung weiter.
Das alles sind Dinge, die einen guten historischen Roman (und als solcher ist er ja auch in Ordnung) auszeichnen.
Für einen Roman über den Jakobsweg, mit dem ich hundertprozentig zufrieden wäre, fehlen mir jedoch eindeutig zu viele Details DARÜBER. Außerdem könnten die Landschaftsbeschreibungen, Beschreibung wichtiger Orte (wiedererkennbarer Orte!), durch die die handelnden Personen ziehen, und deren Hintergründe, ausführlicher sein. Diese Aspekte sind meist sehr vage und flüchtig (ausweichend?) gehalten.
Außerdem zieht sich die Vorgeschichte meiner Ansicht nach sehr lange hin – sie ist interessant und keineswegs langweilig (das hier keine Missverständnisse aufkommen). Aber sie gehört halt – neben den allzu detailreichen Nebenhandlungen auf der ersten Hälfte der Gesamtstrecke – zu den Dingen, die eventuell hätten abgekürzt werden können. Dann wäre auch Zeit (und Papier, Ideen und Schreibenergie) übrig geblieben für den aus meiner Sicht wichtigsten Teil des Jakobsweges.
Dazu kommt dann noch die beschriebene kleinere Ungereimtheit – diese fällt jedoch davor weniger ins Gewicht. Schwerer wiegt das andere.
Es ist auch dies besagte, das mich dazu veranlasst, diesem Roman lediglich 3 Sterne zu verleihen. Denn dieser Makel ist meiner Meinung nach schon wesentlich angesichts des Themas des Buches.
Ich will es so sagen: So, wie es geschrieben steht, hätte es keinen allzu großen Unterschied gemacht, wenn sie statt nach Santiago nach Rom, oder zu einem ganz anderen Ort, gepilgert wären. Ich fand hier nur sehr wenig, was einzig für den Jakobsweg (und nicht auch auf andere Pilgerwege) typisch gewesen wäre.
Geschrieben für: Ciao, Yopi und dooyoo. weiterlesen schließen
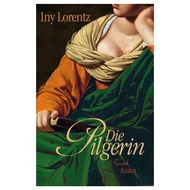
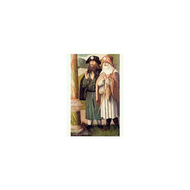


Bewerten / Kommentar schreiben