Erfahrungsbericht von sugips
Literatur als Film!
Pro:
Handlung, Regie, Schauspieler
Kontra:
?????
Empfehlung:
Nein
Die Klavierspielerin
Was hat mich bewegt, in diesen Film zu gehen. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Autorin, Michael Haneke ein ebensolcher Regisseur. Seit seiner Verfilmung von "Das Schloß" nach Franz Kafka für mich auch ein Spezialist für Literatur. Grund genug für mich, wieder einmal das Kino zu besuchen. Und dazu zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen Annie Giradot und Isabelle Huppert, da kann mich nichts mehr aufhalten.
Der Inhalt
Der Film, der auf einem gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks (immerhin schon 1983 erschienen) beruht, handelt vom Leben und den Obsessionen der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert), die mit ihrer Mutter (Annie Girardot) in einer engen und beengten Wohnung lebt. Erika wird von ihrer Mutter kontrolliert und tyrannisiert. Die Mutter brachte Erika eigentlich nur aus einem Grund zur Welt - damit ein Genie aus ihr wird, in Erikas Fall eine Klaviervirtuosin. Leider hat es nur zur Klavierlehrerin gereicht, und unter dieser Schande läßt die Mutter Erika leiden. Erika Kohut arbeitet am Wiener Konservatorium und unterrichtet dort die Studenten in der Handhabung des Pianos. Privat ist sie alles andere als selbstständig, denn mit ihren 40 Jahren steht sie noch gewaltig unter dem Pantoffel ihrer Mutter, die sie permanent kontrolliert und wie ein kleines Kind behandelt. Während Erika den ganzen Tag Klavierunterricht gibt, paßt ihre Mutter auf sie (die um die 40 ist) wie auf ein kleines Kind auf.
Erika gönnt sich aber ein spezielles Hobby: sie besucht heimlich Pornokabinen in Sexshops und "begeilt" sich, während sie sich Blow-Jobs (Französische Liebe) betrachtet, an benutzten Papiertaschentüchern, an denen sie riecht, nichts weiter. Ab und zu findet sie auch Lust, wenn sie neben einem kopulierenden Paar im Autokino mit Lust ihr Wasser lässt. Und ab und zu führt sie sich Rasierklingen ein und findet ein masochistisch-erotisches Vergnügen.
Erika weiß genau, was sie tut. Sie will dieses Leben und macht keinerlei Anstalten, ihre Mutter zu verlassen, was sie finanziell durchaus könnte. Aber sie braucht ihre Mutter. Sie braucht den Ärger und Streit mit ihrer Mutter wie sie die gefühllose Kälte benötigt, die sie ihren Klavierschülern entgegenbringt, während sie gleichzeitig genau weiß, wie man Schubert zu spielen hat. Intellekt geht bei ihr immer vor Gefühl.
Nur eine ihrer Schülerinnen, die von deren Mutter mehr oder weniger gezwungen wird, eine "große Pianistin" zu werden, verzweifelt fast an der Rolle, in die sie andere hineinzwängen. Von der Mutter sekkiert und mit Ehrgeiz angestachelt, von Erika gequält, bleibt sie allerdings dennoch beim Klavierspielen.
Dann erscheint der junge Walter Klemmer - schon ein sprechender Name - (Benoît Magimel), der sich in Erika verliebt. Die wiederum scheint ihn anfänglich abzuweisen, doch diese Abweisung ist kalkuliert. Nicht Liebe ist hier im Spiel, sondern Befriedigung ihrer Lebensart auch im sexuellen Bereich: Sie verlangt von Walter in einem furchtbar langen Brief sadistische Behandlung, Knebeln, Fesseln, Schläge. Sie will Opfer sein, so wie sie Täterin ist. Sie lehnt seine Zuneigung ab, wie sie seine Instrumentalisierung begehrt. "Ich habe keine Gefühle", sagt sie zu ihm, "und wenn ich welche habe, dann siegt meine Intelligenz über sie". Ab diesem Zeitpunkt kann Erika all das in die Wirklichkeit projizieren, was sich bislang aus den gesehenen Pornofilmen in ihr aufgestaut hat. Sie lebt förmlich auf. Anfangs ist das Begehren des jungen Mannes gegenüber der erfahrenen Frau noch riesig groß. Aber dann, nachdem Erika ihm klar gemacht hat, daß sie keine Intimität wünscht, sondern reinste sexuelle Befriedigung, was sogar darin gipfelt, dass sie ihm ihren sexuellen Forderungskatalog präsentiert, in dem alles untergebracht ist, was ihre Augen bis dahin an Sexualpraktiken gesehen haben, wandelt sich das Begehren des jungen Mannes in Abscheu.
Erika will Walter für sich benutzen, und dabei ist ihr die genannte Klavierschülerin im Weg, die sie für eine potentielle Gefahr hält. Sie zerbricht ein Glas und schüttet die Scherben in deren Manteltasche. Die Schülerin verletzt sich derart die Hand, daß sie nicht mehr Klavier spielen kann. Der Mutter der Schülerin, die sich unter Tränen bei ihr darüber beklagt, daß ihre ganzen Pläne nun gescheitert seien, hält sie den Spiegel vor: Sie zwinge doch ihre Tochter in diese Rolle der potentiell erfolgreichen Pianisten, ihre Tochter opfere sich schließlich für ihre Pläne.
Walter, zunächst entsetzt über Erikas Brief, hält sie für krank. Doch dann begibt er sich selbst in diese Welt der tragischen Abhängigkeiten: Er lässt sich am Herrenklo des Wiener Konzerthaus schmerzhaft einen "runterholen" und schaut Erika beim Erbrechen zu, während sie mit ihm nach dem Eishockey-Spiel in einer Kabine oral verkehrt. Am Abend kommt Walter in ihre Wohnung, schließt Erikas Mutter ins Wohnzimmer ein und rächt sich: Er schlägt Erika brutal, zwingt sie zum Geschlechtsverkehr und läßt sie blutend am Boden liegen.
Erika, die anstatt ihrer Schülerin beim Abschlusskonzert des Konservatoriums Klavier spielen soll, packt ein langes Küchenmesser in ihre Handtasche. Im Konservatorium wartet sie auf Walter. Als er lachend mit Freunden an ihr vorbeigeht, nimmt sie schweigend das Messer und durchsticht ihre linke Schulter.
Der Film
Er ist ein abstoßend/anziehendes Meisterwerk, eine dichte Erzählung, die einen in keiner Sekunde kalt oder gleichgültig lässt. Schauspielerische Meisterleistungen von Isabelle Huppert als Klavierlehrerin Kohut, die großartig in all ihren abgründigen Gefühlen, soweit man diese denn noch auszumachen in der Lage ist, ist. Ebenso gut Annie Girardot (als Mutter der Huppert), die diese anspannende, manchmal kaum auszuhaltende Stimmung immer wieder bis hin zu herzlichem Lachen erfrischend bricht. Und nicht zu vergessen Benoît Magimel, der jungedhafte und jungenhafte Liebe, Überheblichkeit, Abschau, Zorn meisterhaft auf die Leinwand bringt.
Der Handlung fehlt jede begleitende Musik, nur das Klavierspiel von Lehrerin und Schülern hört man und einmal den Anklang eines Liedes. Das verstärkt den gespenstisch dichten Eindruck.
Beide Darsteller, Isabelle Huppert und Benoit Magimel bekamen für ihre darstellerischen Leistungen übrigens in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Michael Haneke den großen Preis der Jury für die beste Regie.
Die Klavierspielerin
Österreich, Frankreich 2001, 130 Minuten
Regie: Michael Haneke
Hauptdarsteller: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel
Der Regisseur zu seinem Film
Aus Das Heft: Kino
Dorothée Lackner sprach mit Michael Haneke.
Die Klavierspielerin ist eine hochgradig gestörte Frau. Warum gelingt es uns Normalos trotzdem nicht, uns in der Haltung des Voyeurs bequem zurückzulehnen?
Weil es im Hirn weiterarbeitet. Ich benutze ja gern den Ausnahmefall, um das Typische einer Gesellschaft zu zeigen. Am Extrem lässt sich leichter verdeutlichen, was wir als Normalität empfinden. Über eine private Geschichte lässt sich viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen. Allerdings bin ich nicht bereit, meine eigene Arbeit zu interpretieren. Ich zeige, was es zu zeigen gibt. Das ist alles. Es ist Aufgabe des Zuschauers, das zu bewerten.
Ist es also normal, dass wir keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen haben?
Ganz sicher, das ist ja der Gegenstand vieler meiner Filme. Wir haben alle Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Auch mit dem Gespräch mit uns selbst. Wir befinden uns im Gegenteil des Freiheitszustandes.
Wie genau hält sich die Verfilmung an den Roman?
Ich habe schon versucht, mich möglichst nah an der Geschichte zu bewegen. Andererseits hat ein Roman grundsätzlich andere Strukturen, als es die Dramaturgie eines Filmes erfordert. Deshalb habe ich Parallelen und Ellipsen eingeführt, um der Geschichte eine filmische Struktur zu geben. Zum Beispiel gibt es die zweite Mutter-Tochter-Beziehung im Buch nicht. Aber was die Hauptgeschichte anbelangt, bin ich detailliert am Original geblieben.
Ergibt sich eine andere Sicht auch dadurch, dass der Roman einer Frau von einem Mann verfilmt wurde?
Wenn es so ist, vollzieht es sich außerhalb meiner Kenntnis. Ein Filmemacher wird immer einen anderen Film produzieren als der Autor selbst. Auf das Geschlecht kommt es dabei weniger an.
Wie nah ist das Buch denn Ihrer Meinung nach an den Erfahrungen der Autorin?
An Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen. Elfriede Jelinek selbst macht da widersprüchliche Angaben. Mal hat sie gesagt, es sei ein sehr autobiografisches Buch. Dann wieder fordert sie, den Roman nicht unter diesem Aspekt zu betrachten, weil es die Sache zu sehr einenge. Grundsätzlich ist man dann versucht, etwas als persönliches Problem eines Autors zu sehen. Von ausländischen Journalisten werde ich immer wieder mit Schaudern gefragt, ob denn die Welt in Österreich wirklich so schlecht sei. Damit schiebt man den Film wieder nach Österreich zurück, als hätte man damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt, wenn man alles auf den Autor reduziert. Von mir wird immer behauptet, ich wäre so fasziniert vom Schrecklichen. Mit dem Unterton, ich müsse wohl krank sein. Damit man sich distanziert, sagt man halt, der Regisseur hat ein Problem ? und mit mir hat das nichts zu tun. Ein Mechanismus, der erstaunlich gut funktioniert. Aber so einfach verhält es sich natürlich nicht.
Sind Sie ein Gegner von Filmmusik?
Die Klavierspielerin braucht natürlich Musik, und die Lieder aus Schuberts Winterreise haben einen Bezug zum Geschehen. Insofern hat die Musik hier ihre Berechtigung. In der ersten Hälfte sorgt sie dafür, dass man sich in einem kulturellen Ambiente wohlfühlt. Im zweiten Teil gibt es wenig Musik und auch keinen Grund zum Wohlgefühl. Natürlich ist es eine List, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Auf der anderen Seite war es mir persönlich ein großes Vergnügen, endlich einmal Musik einsetzen zu können. Ich bin ein großer Musikliebhaber, doch in meinen Filmen kann ich sie selten verwenden. Im Kino wird Musik ja gerne dazu benutzt, um die Schwäche der Filme zu kaschieren.
Dienen Sex und Gewalt im Kino auch dazu, Schwierigkeiten zu vertuschen?
Sex und Gewalt werden normalerweise verwendet, um Geschäfte zu machen. Dagegen polemisieren alle meine Filme. Wie ich es mit dem Thema Gewalt in Funny Games getan habe, mache ich es hier mit der Sexualität. Auch Sexualität ist zeigbar, ohne pornografisch zu sein.
Ihr Film löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es gab in Cannes Lacher, Buhrufe und heftigen Applaus. Ist es für Sie wichtig, wie die Leute auf den Film reagieren?
Am liebsten ist es mir, wenn die Leute über meine Filme nachdenken. So möchte ich auch als Zuschauer behandelt werden. Etwas soll sich in Bewegung setzen, damit die zwei Stunden, die ich im Dunkeln verbracht habe, nicht umsonst waren. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute so reagieren, wie es von mir erdacht wurde. Aber in dem Moment, da der Film fertig ist, gehört er nicht mehr mir, sondern dem Publikum. Jeder Zuschauer sieht seinen eigenen Film. Und jeder hat seinen Grund, ihn gut oder schlecht zu finden.
Haben Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Sicher, und ich hoffe doch sehr, dass man das meinen Filmen ansieht. Ich kann doch als Zuschauer nur ein Werk ernst nehmen, wenn ich merke, dass mich der Regisseur respektiert. Was nicht bedeutet, dass ich dem Zuschauer serviere, was er meint, sehen zu wollen. Dann würde ich das machen, was das Fernsehen täglich anrichtet. Mir geht es darum, ihn als Menschen ernst zu nehmen und nicht als Konsumenten zu missbrauchen.
Gehört zum Kino nicht auch der Wunsch, verführen zu wollen?
Mag sein, aber das muss ich ja nicht bedienen. Es gilt, die Eigenständigkeit des Zuschauers zu respektieren. Wenn schon vergewaltigen, dann zur Selbstständigkeit.
Der Regisseur
Michael Haneke, Jahrgang 1942, in München geboren und in Wien aufgewachsen, ist seit 1974 als Regisseur tätig. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit moralisch angehauchten Filmen wie Bennys Video oder Funny Games.
Ein Zitat aus einer Kritik
Wer Bennys Video oder Funny Games gesehen hat, weiß, was einen bei Michael Haneke erwartet: psychologische Entblößungsszenarien, irrationale Gewalt. Dennoch verlässt auch der Hartgesottene das Kino mit weichen Knien. Denn Haneke greift tief in die Abfallgrube menschlicher Gefühle und wirbelt einem das ganze Spektrum (zwischen)menschlichen Horrors um den Kopf. Diesmal sogar ohne moralischen Unterton. Ein Meisterwerk von 130 Minuten, das kein geschmäcklerisches Urteil zulässt.
Dirk Pilz
Die Autorin
Elfriede jelinke wurde am 20.10. 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich geboren. 1970 erschien ihr erster Roman "wir sind lockvögel,baby!", 1983 Die Klavierspielerin, 1984 das Drama "Burgtheater", 1986 erhielt sie den Heinrich-Böll-Preis, 1987 erschien der Roman "Krankheir", 1989 "Lust". Seither sehr viele Romane und Theaterstücke. Derzeit am Wiener Burgtheater die Barbeitung von "Der Jude von Malta" nach Christoper Marlowe. Bekannt auch noch "Gier".
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 17:24:48 mit dem Titel Literatur als Film!
Die Klavierspielerin
Was hat mich bewegt, in diesen Film zu gehen. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Autorin, Michael Haneke ein ebensolcher Regisseur. Seit seiner Verfilmung von "Das Schloß" nach Franz Kafka für mich auch ein Spezialist für Literatur. Grund genug für mich, wieder einmal das Kino zu besuchen. Und dazu zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen Annie Giradot und Isabelle Huppert, da kann mich nichts mehr aufhalten.
Der Inhalt
Der Film, der auf einem gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks (immerhin schon 1983 erschienen) beruht, handelt vom Leben und den Obsessionen der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert), die mit ihrer Mutter (Annie Girardot) in einer engen und beengten Wohnung lebt. Erika wird von ihrer Mutter kontrolliert und tyrannisiert. Die Mutter brachte Erika eigentlich nur aus einem Grund zur Welt - damit ein Genie aus ihr wird, in Erikas Fall eine Klaviervirtuosin. Leider hat es nur zur Klavierlehrerin gereicht, und unter dieser Schande läßt die Mutter Erika leiden. Erika Kohut arbeitet am Wiener Konservatorium und unterrichtet dort die Studenten in der Handhabung des Pianos. Privat ist sie alles andere als selbstständig, denn mit ihren 40 Jahren steht sie noch gewaltig unter dem Pantoffel ihrer Mutter, die sie permanent kontrolliert und wie ein kleines Kind behandelt. Während Erika den ganzen Tag Klavierunterricht gibt, paßt ihre Mutter auf sie (die um die 40 ist) wie auf ein kleines Kind auf.
Erika gönnt sich aber ein spezielles Hobby: sie besucht heimlich Pornokabinen in Sexshops und "begeilt" sich, während sie sich Blow-Jobs (Französische Liebe) betrachtet, an benutzten Papiertaschentüchern, an denen sie riecht, nichts weiter. Ab und zu findet sie auch Lust, wenn sie neben einem kopulierenden Paar im Autokino mit Lust ihr Wasser lässt. Und ab und zu führt sie sich Rasierklingen ein und findet ein masochistisch-erotisches Vergnügen.
Erika weiß genau, was sie tut. Sie will dieses Leben und macht keinerlei Anstalten, ihre Mutter zu verlassen, was sie finanziell durchaus könnte. Aber sie braucht ihre Mutter. Sie braucht den Ärger und Streit mit ihrer Mutter wie sie die gefühllose Kälte benötigt, die sie ihren Klavierschülern entgegenbringt, während sie gleichzeitig genau weiß, wie man Schubert zu spielen hat. Intellekt geht bei ihr immer vor Gefühl.
Nur eine ihrer Schülerinnen, die von deren Mutter mehr oder weniger gezwungen wird, eine "große Pianistin" zu werden, verzweifelt fast an der Rolle, in die sie andere hineinzwängen. Von der Mutter sekkiert und mit Ehrgeiz angestachelt, von Erika gequält, bleibt sie allerdings dennoch beim Klavierspielen.
Dann erscheint der junge Walter Klemmer - schon ein sprechender Name - (Benoît Magimel), der sich in Erika verliebt. Die wiederum scheint ihn anfänglich abzuweisen, doch diese Abweisung ist kalkuliert. Nicht Liebe ist hier im Spiel, sondern Befriedigung ihrer Lebensart auch im sexuellen Bereich: Sie verlangt von Walter in einem furchtbar langen Brief sadistische Behandlung, Knebeln, Fesseln, Schläge. Sie will Opfer sein, so wie sie Täterin ist. Sie lehnt seine Zuneigung ab, wie sie seine Instrumentalisierung begehrt. "Ich habe keine Gefühle", sagt sie zu ihm, "und wenn ich welche habe, dann siegt meine Intelligenz über sie". Ab diesem Zeitpunkt kann Erika all das in die Wirklichkeit projizieren, was sich bislang aus den gesehenen Pornofilmen in ihr aufgestaut hat. Sie lebt förmlich auf. Anfangs ist das Begehren des jungen Mannes gegenüber der erfahrenen Frau noch riesig groß. Aber dann, nachdem Erika ihm klar gemacht hat, daß sie keine Intimität wünscht, sondern reinste sexuelle Befriedigung, was sogar darin gipfelt, dass sie ihm ihren sexuellen Forderungskatalog präsentiert, in dem alles untergebracht ist, was ihre Augen bis dahin an Sexualpraktiken gesehen haben, wandelt sich das Begehren des jungen Mannes in Abscheu.
Erika will Walter für sich benutzen, und dabei ist ihr die genannte Klavierschülerin im Weg, die sie für eine potentielle Gefahr hält. Sie zerbricht ein Glas und schüttet die Scherben in deren Manteltasche. Die Schülerin verletzt sich derart die Hand, daß sie nicht mehr Klavier spielen kann. Der Mutter der Schülerin, die sich unter Tränen bei ihr darüber beklagt, daß ihre ganzen Pläne nun gescheitert seien, hält sie den Spiegel vor: Sie zwinge doch ihre Tochter in diese Rolle der potentiell erfolgreichen Pianisten, ihre Tochter opfere sich schließlich für ihre Pläne.
Walter, zunächst entsetzt über Erikas Brief, hält sie für krank. Doch dann begibt er sich selbst in diese Welt der tragischen Abhängigkeiten: Er lässt sich am Herrenklo des Wiener Konzerthaus schmerzhaft einen "runterholen" und schaut Erika beim Erbrechen zu, während sie mit ihm nach dem Eishockey-Spiel in einer Kabine oral verkehrt. Am Abend kommt Walter in ihre Wohnung, schließt Erikas Mutter ins Wohnzimmer ein und rächt sich: Er schlägt Erika brutal, zwingt sie zum Geschlechtsverkehr und läßt sie blutend am Boden liegen.
Erika, die anstatt ihrer Schülerin beim Abschlusskonzert des Konservatoriums Klavier spielen soll, packt ein langes Küchenmesser in ihre Handtasche. Im Konservatorium wartet sie auf Walter. Als er lachend mit Freunden an ihr vorbeigeht, nimmt sie schweigend das Messer und durchsticht ihre linke Schulter.
Der Film
Er ist ein abstoßend/anziehendes Meisterwerk, eine dichte Erzählung, die einen in keiner Sekunde kalt oder gleichgültig lässt. Schauspielerische Meisterleistungen von Isabelle Huppert als Klavierlehrerin Kohut, die großartig in all ihren abgründigen Gefühlen, soweit man diese denn noch auszumachen in der Lage ist, ist. Ebenso gut Annie Girardot (als Mutter der Huppert), die diese anspannende, manchmal kaum auszuhaltende Stimmung immer wieder bis hin zu herzlichem Lachen erfrischend bricht. Und nicht zu vergessen Benoît Magimel, der jungedhafte und jungenhafte Liebe, Überheblichkeit, Abschau, Zorn meisterhaft auf die Leinwand bringt.
Der Handlung fehlt jede begleitende Musik, nur das Klavierspiel von Lehrerin und Schülern hört man und einmal den Anklang eines Liedes. Das verstärkt den gespenstisch dichten Eindruck.
Beide Darsteller, Isabelle Huppert und Benoit Magimel bekamen für ihre darstellerischen Leistungen übrigens in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Michael Haneke den großen Preis der Jury für die beste Regie.
Die Klavierspielerin
Österreich, Frankreich 2001, 130 Minuten
Regie: Michael Haneke
Hauptdarsteller: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel
Der Regisseur zu seinem Film
Aus Das Heft: Kino
Dorothée Lackner sprach mit Michael Haneke.
Die Klavierspielerin ist eine hochgradig gestörte Frau. Warum gelingt es uns Normalos trotzdem nicht, uns in der Haltung des Voyeurs bequem zurückzulehnen?
Weil es im Hirn weiterarbeitet. Ich benutze ja gern den Ausnahmefall, um das Typische einer Gesellschaft zu zeigen. Am Extrem lässt sich leichter verdeutlichen, was wir als Normalität empfinden. Über eine private Geschichte lässt sich viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen. Allerdings bin ich nicht bereit, meine eigene Arbeit zu interpretieren. Ich zeige, was es zu zeigen gibt. Das ist alles. Es ist Aufgabe des Zuschauers, das zu bewerten.
Ist es also normal, dass wir keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen haben?
Ganz sicher, das ist ja der Gegenstand vieler meiner Filme. Wir haben alle Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Auch mit dem Gespräch mit uns selbst. Wir befinden uns im Gegenteil des Freiheitszustandes.
Wie genau hält sich die Verfilmung an den Roman?
Ich habe schon versucht, mich möglichst nah an der Geschichte zu bewegen. Andererseits hat ein Roman grundsätzlich andere Strukturen, als es die Dramaturgie eines Filmes erfordert. Deshalb habe ich Parallelen und Ellipsen eingeführt, um der Geschichte eine filmische Struktur zu geben. Zum Beispiel gibt es die zweite Mutter-Tochter-Beziehung im Buch nicht. Aber was die Hauptgeschichte anbelangt, bin ich detailliert am Original geblieben.
Ergibt sich eine andere Sicht auch dadurch, dass der Roman einer Frau von einem Mann verfilmt wurde?
Wenn es so ist, vollzieht es sich außerhalb meiner Kenntnis. Ein Filmemacher wird immer einen anderen Film produzieren als der Autor selbst. Auf das Geschlecht kommt es dabei weniger an.
Wie nah ist das Buch denn Ihrer Meinung nach an den Erfahrungen der Autorin?
An Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen. Elfriede Jelinek selbst macht da widersprüchliche Angaben. Mal hat sie gesagt, es sei ein sehr autobiografisches Buch. Dann wieder fordert sie, den Roman nicht unter diesem Aspekt zu betrachten, weil es die Sache zu sehr einenge. Grundsätzlich ist man dann versucht, etwas als persönliches Problem eines Autors zu sehen. Von ausländischen Journalisten werde ich immer wieder mit Schaudern gefragt, ob denn die Welt in Österreich wirklich so schlecht sei. Damit schiebt man den Film wieder nach Österreich zurück, als hätte man damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt, wenn man alles auf den Autor reduziert. Von mir wird immer behauptet, ich wäre so fasziniert vom Schrecklichen. Mit dem Unterton, ich müsse wohl krank sein. Damit man sich distanziert, sagt man halt, der Regisseur hat ein Problem ? und mit mir hat das nichts zu tun. Ein Mechanismus, der erstaunlich gut funktioniert. Aber so einfach verhält es sich natürlich nicht.
Sind Sie ein Gegner von Filmmusik?
Die Klavierspielerin braucht natürlich Musik, und die Lieder aus Schuberts Winterreise haben einen Bezug zum Geschehen. Insofern hat die Musik hier ihre Berechtigung. In der ersten Hälfte sorgt sie dafür, dass man sich in einem kulturellen Ambiente wohlfühlt. Im zweiten Teil gibt es wenig Musik und auch keinen Grund zum Wohlgefühl. Natürlich ist es eine List, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Auf der anderen Seite war es mir persönlich ein großes Vergnügen, endlich einmal Musik einsetzen zu können. Ich bin ein großer Musikliebhaber, doch in meinen Filmen kann ich sie selten verwenden. Im Kino wird Musik ja gerne dazu benutzt, um die Schwäche der Filme zu kaschieren.
Dienen Sex und Gewalt im Kino auch dazu, Schwierigkeiten zu vertuschen?
Sex und Gewalt werden normalerweise verwendet, um Geschäfte zu machen. Dagegen polemisieren alle meine Filme. Wie ich es mit dem Thema Gewalt in Funny Games getan habe, mache ich es hier mit der Sexualität. Auch Sexualität ist zeigbar, ohne pornografisch zu sein.
Ihr Film löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es gab in Cannes Lacher, Buhrufe und heftigen Applaus. Ist es für Sie wichtig, wie die Leute auf den Film reagieren?
Am liebsten ist es mir, wenn die Leute über meine Filme nachdenken. So möchte ich auch als Zuschauer behandelt werden. Etwas soll sich in Bewegung setzen, damit die zwei Stunden, die ich im Dunkeln verbracht habe, nicht umsonst waren. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute so reagieren, wie es von mir erdacht wurde. Aber in dem Moment, da der Film fertig ist, gehört er nicht mehr mir, sondern dem Publikum. Jeder Zuschauer sieht seinen eigenen Film. Und jeder hat seinen Grund, ihn gut oder schlecht zu finden.
Haben Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Sicher, und ich hoffe doch sehr, dass man das meinen Filmen ansieht. Ich kann doch als Zuschauer nur ein Werk ernst nehmen, wenn ich merke, dass mich der Regisseur respektiert. Was nicht bedeutet, dass ich dem Zuschauer serviere, was er meint, sehen zu wollen. Dann würde ich das machen, was das Fernsehen täglich anrichtet. Mir geht es darum, ihn als Menschen ernst zu nehmen und nicht als Konsumenten zu missbrauchen.
Gehört zum Kino nicht auch der Wunsch, verführen zu wollen?
Mag sein, aber das muss ich ja nicht bedienen. Es gilt, die Eigenständigkeit des Zuschauers zu respektieren. Wenn schon vergewaltigen, dann zur Selbstständigkeit.
Der Regisseur
Michael Haneke, Jahrgang 1942, in München geboren und in Wien aufgewachsen, ist seit 1974 als Regisseur tätig. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit moralisch angehauchten Filmen wie Bennys Video oder Funny Games.
Ein Zitat aus einer Kritik
Wer Bennys Video oder Funny Games gesehen hat, weiß, was einen bei Michael Haneke erwartet: psychologische Entblößungsszenarien, irrationale Gewalt. Dennoch verlässt auch der Hartgesottene das Kino mit weichen Knien. Denn Haneke greift tief in die Abfallgrube menschlicher Gefühle und wirbelt einem das ganze Spektrum (zwischen)menschlichen Horrors um den Kopf. Diesmal sogar ohne moralischen Unterton. Ein Meisterwerk von 130 Minuten, das kein geschmäcklerisches Urteil zulässt.
Dirk Pilz
Die Autorin
Elfriede jelinke wurde am 20.10. 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich geboren. 1970 erschien ihr erster Roman "wir sind lockvögel,baby!", 1983 Die Klavierspielerin, 1984 das Drama "Burgtheater", 1986 erhielt sie den Heinrich-Böll-Preis, 1987 erschien der Roman "Krankheir", 1989 "Lust". Seither sehr viele Romane und Theaterstücke. Derzeit am Wiener Burgtheater die Barbeitung von "Der Jude von Malta" nach Christoper Marlowe. Bekannt auch noch "Gier".
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 17:25:04 mit dem Titel Literatur als Film!
Die Klavierspielerin
Was hat mich bewegt, in diesen Film zu gehen. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Autorin, Michael Haneke ein ebensolcher Regisseur. Seit seiner Verfilmung von "Das Schloß" nach Franz Kafka für mich auch ein Spezialist für Literatur. Grund genug für mich, wieder einmal das Kino zu besuchen. Und dazu zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen Annie Giradot und Isabelle Huppert, da kann mich nichts mehr aufhalten.
Der Inhalt
Der Film, der auf einem gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks (immerhin schon 1983 erschienen) beruht, handelt vom Leben und den Obsessionen der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert), die mit ihrer Mutter (Annie Girardot) in einer engen und beengten Wohnung lebt. Erika wird von ihrer Mutter kontrolliert und tyrannisiert. Die Mutter brachte Erika eigentlich nur aus einem Grund zur Welt - damit ein Genie aus ihr wird, in Erikas Fall eine Klaviervirtuosin. Leider hat es nur zur Klavierlehrerin gereicht, und unter dieser Schande läßt die Mutter Erika leiden. Erika Kohut arbeitet am Wiener Konservatorium und unterrichtet dort die Studenten in der Handhabung des Pianos. Privat ist sie alles andere als selbstständig, denn mit ihren 40 Jahren steht sie noch gewaltig unter dem Pantoffel ihrer Mutter, die sie permanent kontrolliert und wie ein kleines Kind behandelt. Während Erika den ganzen Tag Klavierunterricht gibt, paßt ihre Mutter auf sie (die um die 40 ist) wie auf ein kleines Kind auf.
Erika gönnt sich aber ein spezielles Hobby: sie besucht heimlich Pornokabinen in Sexshops und "begeilt" sich, während sie sich Blow-Jobs (Französische Liebe) betrachtet, an benutzten Papiertaschentüchern, an denen sie riecht, nichts weiter. Ab und zu findet sie auch Lust, wenn sie neben einem kopulierenden Paar im Autokino mit Lust ihr Wasser lässt. Und ab und zu führt sie sich Rasierklingen ein und findet ein masochistisch-erotisches Vergnügen.
Erika weiß genau, was sie tut. Sie will dieses Leben und macht keinerlei Anstalten, ihre Mutter zu verlassen, was sie finanziell durchaus könnte. Aber sie braucht ihre Mutter. Sie braucht den Ärger und Streit mit ihrer Mutter wie sie die gefühllose Kälte benötigt, die sie ihren Klavierschülern entgegenbringt, während sie gleichzeitig genau weiß, wie man Schubert zu spielen hat. Intellekt geht bei ihr immer vor Gefühl.
Nur eine ihrer Schülerinnen, die von deren Mutter mehr oder weniger gezwungen wird, eine "große Pianistin" zu werden, verzweifelt fast an der Rolle, in die sie andere hineinzwängen. Von der Mutter sekkiert und mit Ehrgeiz angestachelt, von Erika gequält, bleibt sie allerdings dennoch beim Klavierspielen.
Dann erscheint der junge Walter Klemmer - schon ein sprechender Name - (Benoît Magimel), der sich in Erika verliebt. Die wiederum scheint ihn anfänglich abzuweisen, doch diese Abweisung ist kalkuliert. Nicht Liebe ist hier im Spiel, sondern Befriedigung ihrer Lebensart auch im sexuellen Bereich: Sie verlangt von Walter in einem furchtbar langen Brief sadistische Behandlung, Knebeln, Fesseln, Schläge. Sie will Opfer sein, so wie sie Täterin ist. Sie lehnt seine Zuneigung ab, wie sie seine Instrumentalisierung begehrt. "Ich habe keine Gefühle", sagt sie zu ihm, "und wenn ich welche habe, dann siegt meine Intelligenz über sie". Ab diesem Zeitpunkt kann Erika all das in die Wirklichkeit projizieren, was sich bislang aus den gesehenen Pornofilmen in ihr aufgestaut hat. Sie lebt förmlich auf. Anfangs ist das Begehren des jungen Mannes gegenüber der erfahrenen Frau noch riesig groß. Aber dann, nachdem Erika ihm klar gemacht hat, daß sie keine Intimität wünscht, sondern reinste sexuelle Befriedigung, was sogar darin gipfelt, dass sie ihm ihren sexuellen Forderungskatalog präsentiert, in dem alles untergebracht ist, was ihre Augen bis dahin an Sexualpraktiken gesehen haben, wandelt sich das Begehren des jungen Mannes in Abscheu.
Erika will Walter für sich benutzen, und dabei ist ihr die genannte Klavierschülerin im Weg, die sie für eine potentielle Gefahr hält. Sie zerbricht ein Glas und schüttet die Scherben in deren Manteltasche. Die Schülerin verletzt sich derart die Hand, daß sie nicht mehr Klavier spielen kann. Der Mutter der Schülerin, die sich unter Tränen bei ihr darüber beklagt, daß ihre ganzen Pläne nun gescheitert seien, hält sie den Spiegel vor: Sie zwinge doch ihre Tochter in diese Rolle der potentiell erfolgreichen Pianisten, ihre Tochter opfere sich schließlich für ihre Pläne.
Walter, zunächst entsetzt über Erikas Brief, hält sie für krank. Doch dann begibt er sich selbst in diese Welt der tragischen Abhängigkeiten: Er lässt sich am Herrenklo des Wiener Konzerthaus schmerzhaft einen "runterholen" und schaut Erika beim Erbrechen zu, während sie mit ihm nach dem Eishockey-Spiel in einer Kabine oral verkehrt. Am Abend kommt Walter in ihre Wohnung, schließt Erikas Mutter ins Wohnzimmer ein und rächt sich: Er schlägt Erika brutal, zwingt sie zum Geschlechtsverkehr und läßt sie blutend am Boden liegen.
Erika, die anstatt ihrer Schülerin beim Abschlusskonzert des Konservatoriums Klavier spielen soll, packt ein langes Küchenmesser in ihre Handtasche. Im Konservatorium wartet sie auf Walter. Als er lachend mit Freunden an ihr vorbeigeht, nimmt sie schweigend das Messer und durchsticht ihre linke Schulter.
Der Film
Er ist ein abstoßend/anziehendes Meisterwerk, eine dichte Erzählung, die einen in keiner Sekunde kalt oder gleichgültig lässt. Schauspielerische Meisterleistungen von Isabelle Huppert als Klavierlehrerin Kohut, die großartig in all ihren abgründigen Gefühlen, soweit man diese denn noch auszumachen in der Lage ist, ist. Ebenso gut Annie Girardot (als Mutter der Huppert), die diese anspannende, manchmal kaum auszuhaltende Stimmung immer wieder bis hin zu herzlichem Lachen erfrischend bricht. Und nicht zu vergessen Benoît Magimel, der jungedhafte und jungenhafte Liebe, Überheblichkeit, Abschau, Zorn meisterhaft auf die Leinwand bringt.
Der Handlung fehlt jede begleitende Musik, nur das Klavierspiel von Lehrerin und Schülern hört man und einmal den Anklang eines Liedes. Das verstärkt den gespenstisch dichten Eindruck.
Beide Darsteller, Isabelle Huppert und Benoit Magimel bekamen für ihre darstellerischen Leistungen übrigens in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Michael Haneke den großen Preis der Jury für die beste Regie.
Die Klavierspielerin
Österreich, Frankreich 2001, 130 Minuten
Regie: Michael Haneke
Hauptdarsteller: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel
Der Regisseur zu seinem Film
Aus Das Heft: Kino
Dorothée Lackner sprach mit Michael Haneke.
Die Klavierspielerin ist eine hochgradig gestörte Frau. Warum gelingt es uns Normalos trotzdem nicht, uns in der Haltung des Voyeurs bequem zurückzulehnen?
Weil es im Hirn weiterarbeitet. Ich benutze ja gern den Ausnahmefall, um das Typische einer Gesellschaft zu zeigen. Am Extrem lässt sich leichter verdeutlichen, was wir als Normalität empfinden. Über eine private Geschichte lässt sich viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen. Allerdings bin ich nicht bereit, meine eigene Arbeit zu interpretieren. Ich zeige, was es zu zeigen gibt. Das ist alles. Es ist Aufgabe des Zuschauers, das zu bewerten.
Ist es also normal, dass wir keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen haben?
Ganz sicher, das ist ja der Gegenstand vieler meiner Filme. Wir haben alle Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Auch mit dem Gespräch mit uns selbst. Wir befinden uns im Gegenteil des Freiheitszustandes.
Wie genau hält sich die Verfilmung an den Roman?
Ich habe schon versucht, mich möglichst nah an der Geschichte zu bewegen. Andererseits hat ein Roman grundsätzlich andere Strukturen, als es die Dramaturgie eines Filmes erfordert. Deshalb habe ich Parallelen und Ellipsen eingeführt, um der Geschichte eine filmische Struktur zu geben. Zum Beispiel gibt es die zweite Mutter-Tochter-Beziehung im Buch nicht. Aber was die Hauptgeschichte anbelangt, bin ich detailliert am Original geblieben.
Ergibt sich eine andere Sicht auch dadurch, dass der Roman einer Frau von einem Mann verfilmt wurde?
Wenn es so ist, vollzieht es sich außerhalb meiner Kenntnis. Ein Filmemacher wird immer einen anderen Film produzieren als der Autor selbst. Auf das Geschlecht kommt es dabei weniger an.
Wie nah ist das Buch denn Ihrer Meinung nach an den Erfahrungen der Autorin?
An Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen. Elfriede Jelinek selbst macht da widersprüchliche Angaben. Mal hat sie gesagt, es sei ein sehr autobiografisches Buch. Dann wieder fordert sie, den Roman nicht unter diesem Aspekt zu betrachten, weil es die Sache zu sehr einenge. Grundsätzlich ist man dann versucht, etwas als persönliches Problem eines Autors zu sehen. Von ausländischen Journalisten werde ich immer wieder mit Schaudern gefragt, ob denn die Welt in Österreich wirklich so schlecht sei. Damit schiebt man den Film wieder nach Österreich zurück, als hätte man damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt, wenn man alles auf den Autor reduziert. Von mir wird immer behauptet, ich wäre so fasziniert vom Schrecklichen. Mit dem Unterton, ich müsse wohl krank sein. Damit man sich distanziert, sagt man halt, der Regisseur hat ein Problem ? und mit mir hat das nichts zu tun. Ein Mechanismus, der erstaunlich gut funktioniert. Aber so einfach verhält es sich natürlich nicht.
Sind Sie ein Gegner von Filmmusik?
Die Klavierspielerin braucht natürlich Musik, und die Lieder aus Schuberts Winterreise haben einen Bezug zum Geschehen. Insofern hat die Musik hier ihre Berechtigung. In der ersten Hälfte sorgt sie dafür, dass man sich in einem kulturellen Ambiente wohlfühlt. Im zweiten Teil gibt es wenig Musik und auch keinen Grund zum Wohlgefühl. Natürlich ist es eine List, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Auf der anderen Seite war es mir persönlich ein großes Vergnügen, endlich einmal Musik einsetzen zu können. Ich bin ein großer Musikliebhaber, doch in meinen Filmen kann ich sie selten verwenden. Im Kino wird Musik ja gerne dazu benutzt, um die Schwäche der Filme zu kaschieren.
Dienen Sex und Gewalt im Kino auch dazu, Schwierigkeiten zu vertuschen?
Sex und Gewalt werden normalerweise verwendet, um Geschäfte zu machen. Dagegen polemisieren alle meine Filme. Wie ich es mit dem Thema Gewalt in Funny Games getan habe, mache ich es hier mit der Sexualität. Auch Sexualität ist zeigbar, ohne pornografisch zu sein.
Ihr Film löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es gab in Cannes Lacher, Buhrufe und heftigen Applaus. Ist es für Sie wichtig, wie die Leute auf den Film reagieren?
Am liebsten ist es mir, wenn die Leute über meine Filme nachdenken. So möchte ich auch als Zuschauer behandelt werden. Etwas soll sich in Bewegung setzen, damit die zwei Stunden, die ich im Dunkeln verbracht habe, nicht umsonst waren. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute so reagieren, wie es von mir erdacht wurde. Aber in dem Moment, da der Film fertig ist, gehört er nicht mehr mir, sondern dem Publikum. Jeder Zuschauer sieht seinen eigenen Film. Und jeder hat seinen Grund, ihn gut oder schlecht zu finden.
Haben Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Sicher, und ich hoffe doch sehr, dass man das meinen Filmen ansieht. Ich kann doch als Zuschauer nur ein Werk ernst nehmen, wenn ich merke, dass mich der Regisseur respektiert. Was nicht bedeutet, dass ich dem Zuschauer serviere, was er meint, sehen zu wollen. Dann würde ich das machen, was das Fernsehen täglich anrichtet. Mir geht es darum, ihn als Menschen ernst zu nehmen und nicht als Konsumenten zu missbrauchen.
Gehört zum Kino nicht auch der Wunsch, verführen zu wollen?
Mag sein, aber das muss ich ja nicht bedienen. Es gilt, die Eigenständigkeit des Zuschauers zu respektieren. Wenn schon vergewaltigen, dann zur Selbstständigkeit.
Der Regisseur
Michael Haneke, Jahrgang 1942, in München geboren und in Wien aufgewachsen, ist seit 1974 als Regisseur tätig. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit moralisch angehauchten Filmen wie Bennys Video oder Funny Games.
Ein Zitat aus einer Kritik
Wer Bennys Video oder Funny Games gesehen hat, weiß, was einen bei Michael Haneke erwartet: psychologische Entblößungsszenarien, irrationale Gewalt. Dennoch verlässt auch der Hartgesottene das Kino mit weichen Knien. Denn Haneke greift tief in die Abfallgrube menschlicher Gefühle und wirbelt einem das ganze Spektrum (zwischen)menschlichen Horrors um den Kopf. Diesmal sogar ohne moralischen Unterton. Ein Meisterwerk von 130 Minuten, das kein geschmäcklerisches Urteil zulässt.
Dirk Pilz
Die Autorin
Elfriede jelinke wurde am 20.10. 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich geboren. 1970 erschien ihr erster Roman "wir sind lockvögel,baby!", 1983 Die Klavierspielerin, 1984 das Drama "Burgtheater", 1986 erhielt sie den Heinrich-Böll-Preis, 1987 erschien der Roman "Krankheir", 1989 "Lust". Seither sehr viele Romane und Theaterstücke. Derzeit am Wiener Burgtheater die Barbeitung von "Der Jude von Malta" nach Christoper Marlowe. Bekannt auch noch "Gier".
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 18:08:21 mit dem Titel Die fabelhafte Welt der Amélie
Schön langsam entdecke ich wieder meine Liebe zum französischen Film. Nach Chocolat nun in ?Die fabelhafte Welt der Amélie?, wie leider öfters üblich eine völlig unnötig falsche Übersetzung des Originals ?Das fabelhafte Schicksal der Amélie Poulain?, aber dafür hat es schlimmere Beispiele gegeben. Den Regisseur Jean-Pierre Jeunet kannte ich schon von Delicatessen (1991), der Endzeitstimmung über Menschenfresser in einer zerstörten französischen Stadt. Dieser sein neuester Film hat aber mit Endzeit und Tristesse gar nichts zu tun, er ist ein modernes Märchen.
Die Handlung:
Hauptort der Handlung ist Paris. Die Titelrolle Amélie, Angang 20, (gespielt von Audrey Tautou) arbeitet als Kellnerin im Café des Deux Moulins am Montmartre. Sie lebt alleine eine schüchterne junge Frau. In einer Rückblende wird ihre überbehütete Kindheit gezeigt: kein Spielen mit anderen Kindern, aber auch kein liebevolles Gespräch, kein Liebe auch im Elternhaus. Der Vater verschlossen, nur an seiner Arbeit und dem Garten interessiert, die Mutter ebenso schüchtern wie sie. Als die Mutter stirbt, baut der Vater ein Mausoleum im Garten, mit Pflanzen, Steinen und Gartenzwerge, Amélie übersiedelt nach Paris, in eine winzige Wohnung, findet kaum Freunde und beschließt nach unbefriedigenden Sexualerlebnissen auch auf Männer weitestgehend zu verzichten. Sie entdeckt ihre einzige Mission: andere Menschen glücklich machen zu wollen.
Sie stiehlt den Lieblingsgartenzwerg ihres Vaters und schickt diesen mit einer Bekannten auf Weltreise. Von dort bekommt ihr Vater laufend Fotos des Zwerges vor bedeutenden Monumenten, um den Vater zu einer Reise zu überreden. Sie sucht und findet den Besitzer von Kinderspielzeug, das sie in einer verborgenen Mauernische ihrer Wohnung findet, sie schreibt im Namen eines toten Liebesbriefe an einer verlassene Hausbewohnerin und lässt diese dadurch wieder an Liebe glauben, sie lässt Gedichte auf Häuserwände schreiben ... .
Ihre fabelhafte Welt ist ein magischer Ort voll großer Wunder und kleiner Geheimnisse. ?Sie kümmert sich um die Menschen?, weiß ihr Freund, der einsame Maler im Nebenhaus, der seine Wohnung wegen einer schrechlichen Krankheit (Glasknochen, die bei der kleinesten Anstrengung brechen können) seine Wohnung seit 20 Jahren nicht verlassen hat. ?Doch wer kümmert sich um sie??
Nino Quincampoix (gespielt von Mathieu Kassovitz, den man auch als Regisseur kennt) arbeitet als Kassierer in einem Porno-Videoshop, nebenbei als Gespenst in einer Geisterbahn. In seiner Freizeit sammelt er die Fotos, die Menschen vor Fotoautomaten wegwerfen, weil ihnen die Bilder nicht gefallen haben. Dabei ?jagt? er einem geheimnisvollen Fremden hinterher, dessen Fotos er immer wieder bei verschiedenen Automaten findet. Auch dieses Geheimnis wird Amélie letztendlich für ihn lösen. Nino könnte Amélies große Liebe werden. Aber nur wenn alles gut geht. Denn ab und zu hat auch Amélie Pech, den das Schicksal will auch nicht immer so, wie sie will.
Die Schauspieler:
Der Film ist auch die Geburt einer großartigen Schauspielerin, Audrey Tautou. Der Regisseur entdeckte sie auf einem Filmplakat. ?Ich sah ein Paar dunkler Augen, einen Hauch von Unschuld und einen ganz und gar ungewöhnlichen Gesichtsausdruck. Nach zehn Sekunden war mir klar: diese Frau ist perfekt für meinen Film?. Und recht hat er gehabt. In einem durchgängig ganz und gar großartigen Ensemble ist sie der Sztar. Zum Verlieben liebenswert, ganz zart im Ausdruck und immer präsent. Sie allein lohnt schon den Besuch dieses Filmes für die ganze Familie.
Die Empfehlun:
Partner nehmen, Freunde nehmen, Kinder nehmen und anschauen. Ein wenig schmusen und genießen. Einer der besten Filme dieser Saison.
Zuletzt die Fakten:
Die fabelhafte Welt der Amélie (le fabuleux destin d?amélie Poulain)
Frankreich/Deutschland 2001. Regie: Jean-Pierre Jeunet. Produktion: Claudie Ossard. Buch. Gauillaume Laurant, : Jean-Pierre Jeunet. Kamera: Bruno Delbonnel. Schnitt: Hervé Schneid. Musik: Yann Tiersen. Länge: 120 Minuten. Mit Audrey Tautou (Amélie), Mathieu Kassovitz (Nino), Rufus, Yolande Moreau, Artus Penguern, Urbain Cancellier, Dominique Pinon.
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 19:37:12 mit dem Titel Ach wie verführerisch...
CHOCOLAR
Jetzt versuche ich mich zum ersten Mal über einen Film. Bin sonst eher ein Theater-Geher. Aber die Vorberichte und die Geschichte haben mich schon sehr interessiert und Juliette Binoche mag ich sehr.
Die Geschichte erzählt das Leben in einem kleinen französischen Dorf, in das eine Schokoladen-Macherin (Juliette Binoche) kommt und es durch ihre ungewöhnliche Lebensweise und Lebensgeschichte gehörig in Aufregung versetzt. Eine Zigeunerin, die das Handwerk über Generationen mitbekommen hat und bis zur Perfektion beherrscht. Sie mischt Chili und Pfefer und allerlei sonstige exotische Gewürze in ihre Süssigkeiten, hat eine uneheliche Tochter und gibt wenig auf Religion und Vorurteile. Das macht sie verdächtig: vor allem in den Augen der Frauen. Die Männer kocht sie mit ihren Leckereien immer mehr ein. Bis auf den Bürgermeister, einen alten Adeligen, den seinen Frau verlassen hat, und der dadurch immer verbitterter wird und jeden Spaß am Leben verloren hat; das verlangt er auch von seinen Mitbürgern.
Als sich die Schokoladenmacherin auch noch in einen Zigeuenr und Theatermacher verliebt (Johnny Depp), bringt sie das Faß zum Überlaufen. Die Boote der Zigeuner werden angezündet, ihre Tochter kommt fast ums Leben. Sie will nichts wie weg. Am Schluß beschließt sie aber, die karriere - immer wieder von Ort zu Ort zu ziehen, zu beenden, bleibt im Ort, Johnny Depp kommt zurück, der Bürgermeister wird entlarvt, bekehrt und alle sind glücklich.
Es ist ein sehr schöner und sensibler Film. Wunderschöne Bilder des ortes, der Natur, der menschen und der Schokoladen - tiefe Einblicke in das Seelenleben von Klein- und Großbürgern. der Mann, der eine Frau seit Jahren liebt und sich ihr nicht zu nähern traut, weil ihre Trauerzeit angeblich nicht zu Ende ist; die bigotte Tochter, die ihre Mutter in ein Heim abschieben will und ihr ihr letztes Glück kurz vor dem Sterben nicht gönnt; der Pfarrer, der sich die Predigten vom Bürgermeister vorschreiben läßt, und seine liberaleren Ansichten nicht zum Durchbruch kommen läßt; man könnte stundenlang erzählen.
Lasse Hallstroem hat einen sehr besinnlichen Film gemacht, der nicht nur von den Hauptdarstellern exzellent gespielt wird. Er macht Freude, rührt teilweise zu Tränen und regt sehr zum Nachdenken über seine eigenen Unzulänglichkeiten an. Actionfans sollten ihn großräumig meiden, alle, die einen sehr guten, sehr anrührenden Film sehen wollen, sollten hineingehen, solange er noch irgendwo gespielt wird.
Achja: wenn auch nicht zum Schmusen, dafür ist er zu gut, aber zum Händchenhalten mit meiner Herzallerliebsten ist er auch bestens geeignet.
Was hat mich bewegt, in diesen Film zu gehen. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Autorin, Michael Haneke ein ebensolcher Regisseur. Seit seiner Verfilmung von "Das Schloß" nach Franz Kafka für mich auch ein Spezialist für Literatur. Grund genug für mich, wieder einmal das Kino zu besuchen. Und dazu zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen Annie Giradot und Isabelle Huppert, da kann mich nichts mehr aufhalten.
Der Inhalt
Der Film, der auf einem gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks (immerhin schon 1983 erschienen) beruht, handelt vom Leben und den Obsessionen der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert), die mit ihrer Mutter (Annie Girardot) in einer engen und beengten Wohnung lebt. Erika wird von ihrer Mutter kontrolliert und tyrannisiert. Die Mutter brachte Erika eigentlich nur aus einem Grund zur Welt - damit ein Genie aus ihr wird, in Erikas Fall eine Klaviervirtuosin. Leider hat es nur zur Klavierlehrerin gereicht, und unter dieser Schande läßt die Mutter Erika leiden. Erika Kohut arbeitet am Wiener Konservatorium und unterrichtet dort die Studenten in der Handhabung des Pianos. Privat ist sie alles andere als selbstständig, denn mit ihren 40 Jahren steht sie noch gewaltig unter dem Pantoffel ihrer Mutter, die sie permanent kontrolliert und wie ein kleines Kind behandelt. Während Erika den ganzen Tag Klavierunterricht gibt, paßt ihre Mutter auf sie (die um die 40 ist) wie auf ein kleines Kind auf.
Erika gönnt sich aber ein spezielles Hobby: sie besucht heimlich Pornokabinen in Sexshops und "begeilt" sich, während sie sich Blow-Jobs (Französische Liebe) betrachtet, an benutzten Papiertaschentüchern, an denen sie riecht, nichts weiter. Ab und zu findet sie auch Lust, wenn sie neben einem kopulierenden Paar im Autokino mit Lust ihr Wasser lässt. Und ab und zu führt sie sich Rasierklingen ein und findet ein masochistisch-erotisches Vergnügen.
Erika weiß genau, was sie tut. Sie will dieses Leben und macht keinerlei Anstalten, ihre Mutter zu verlassen, was sie finanziell durchaus könnte. Aber sie braucht ihre Mutter. Sie braucht den Ärger und Streit mit ihrer Mutter wie sie die gefühllose Kälte benötigt, die sie ihren Klavierschülern entgegenbringt, während sie gleichzeitig genau weiß, wie man Schubert zu spielen hat. Intellekt geht bei ihr immer vor Gefühl.
Nur eine ihrer Schülerinnen, die von deren Mutter mehr oder weniger gezwungen wird, eine "große Pianistin" zu werden, verzweifelt fast an der Rolle, in die sie andere hineinzwängen. Von der Mutter sekkiert und mit Ehrgeiz angestachelt, von Erika gequält, bleibt sie allerdings dennoch beim Klavierspielen.
Dann erscheint der junge Walter Klemmer - schon ein sprechender Name - (Benoît Magimel), der sich in Erika verliebt. Die wiederum scheint ihn anfänglich abzuweisen, doch diese Abweisung ist kalkuliert. Nicht Liebe ist hier im Spiel, sondern Befriedigung ihrer Lebensart auch im sexuellen Bereich: Sie verlangt von Walter in einem furchtbar langen Brief sadistische Behandlung, Knebeln, Fesseln, Schläge. Sie will Opfer sein, so wie sie Täterin ist. Sie lehnt seine Zuneigung ab, wie sie seine Instrumentalisierung begehrt. "Ich habe keine Gefühle", sagt sie zu ihm, "und wenn ich welche habe, dann siegt meine Intelligenz über sie". Ab diesem Zeitpunkt kann Erika all das in die Wirklichkeit projizieren, was sich bislang aus den gesehenen Pornofilmen in ihr aufgestaut hat. Sie lebt förmlich auf. Anfangs ist das Begehren des jungen Mannes gegenüber der erfahrenen Frau noch riesig groß. Aber dann, nachdem Erika ihm klar gemacht hat, daß sie keine Intimität wünscht, sondern reinste sexuelle Befriedigung, was sogar darin gipfelt, dass sie ihm ihren sexuellen Forderungskatalog präsentiert, in dem alles untergebracht ist, was ihre Augen bis dahin an Sexualpraktiken gesehen haben, wandelt sich das Begehren des jungen Mannes in Abscheu.
Erika will Walter für sich benutzen, und dabei ist ihr die genannte Klavierschülerin im Weg, die sie für eine potentielle Gefahr hält. Sie zerbricht ein Glas und schüttet die Scherben in deren Manteltasche. Die Schülerin verletzt sich derart die Hand, daß sie nicht mehr Klavier spielen kann. Der Mutter der Schülerin, die sich unter Tränen bei ihr darüber beklagt, daß ihre ganzen Pläne nun gescheitert seien, hält sie den Spiegel vor: Sie zwinge doch ihre Tochter in diese Rolle der potentiell erfolgreichen Pianisten, ihre Tochter opfere sich schließlich für ihre Pläne.
Walter, zunächst entsetzt über Erikas Brief, hält sie für krank. Doch dann begibt er sich selbst in diese Welt der tragischen Abhängigkeiten: Er lässt sich am Herrenklo des Wiener Konzerthaus schmerzhaft einen "runterholen" und schaut Erika beim Erbrechen zu, während sie mit ihm nach dem Eishockey-Spiel in einer Kabine oral verkehrt. Am Abend kommt Walter in ihre Wohnung, schließt Erikas Mutter ins Wohnzimmer ein und rächt sich: Er schlägt Erika brutal, zwingt sie zum Geschlechtsverkehr und läßt sie blutend am Boden liegen.
Erika, die anstatt ihrer Schülerin beim Abschlusskonzert des Konservatoriums Klavier spielen soll, packt ein langes Küchenmesser in ihre Handtasche. Im Konservatorium wartet sie auf Walter. Als er lachend mit Freunden an ihr vorbeigeht, nimmt sie schweigend das Messer und durchsticht ihre linke Schulter.
Der Film
Er ist ein abstoßend/anziehendes Meisterwerk, eine dichte Erzählung, die einen in keiner Sekunde kalt oder gleichgültig lässt. Schauspielerische Meisterleistungen von Isabelle Huppert als Klavierlehrerin Kohut, die großartig in all ihren abgründigen Gefühlen, soweit man diese denn noch auszumachen in der Lage ist, ist. Ebenso gut Annie Girardot (als Mutter der Huppert), die diese anspannende, manchmal kaum auszuhaltende Stimmung immer wieder bis hin zu herzlichem Lachen erfrischend bricht. Und nicht zu vergessen Benoît Magimel, der jungedhafte und jungenhafte Liebe, Überheblichkeit, Abschau, Zorn meisterhaft auf die Leinwand bringt.
Der Handlung fehlt jede begleitende Musik, nur das Klavierspiel von Lehrerin und Schülern hört man und einmal den Anklang eines Liedes. Das verstärkt den gespenstisch dichten Eindruck.
Beide Darsteller, Isabelle Huppert und Benoit Magimel bekamen für ihre darstellerischen Leistungen übrigens in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Michael Haneke den großen Preis der Jury für die beste Regie.
Die Klavierspielerin
Österreich, Frankreich 2001, 130 Minuten
Regie: Michael Haneke
Hauptdarsteller: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel
Der Regisseur zu seinem Film
Aus Das Heft: Kino
Dorothée Lackner sprach mit Michael Haneke.
Die Klavierspielerin ist eine hochgradig gestörte Frau. Warum gelingt es uns Normalos trotzdem nicht, uns in der Haltung des Voyeurs bequem zurückzulehnen?
Weil es im Hirn weiterarbeitet. Ich benutze ja gern den Ausnahmefall, um das Typische einer Gesellschaft zu zeigen. Am Extrem lässt sich leichter verdeutlichen, was wir als Normalität empfinden. Über eine private Geschichte lässt sich viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen. Allerdings bin ich nicht bereit, meine eigene Arbeit zu interpretieren. Ich zeige, was es zu zeigen gibt. Das ist alles. Es ist Aufgabe des Zuschauers, das zu bewerten.
Ist es also normal, dass wir keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen haben?
Ganz sicher, das ist ja der Gegenstand vieler meiner Filme. Wir haben alle Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Auch mit dem Gespräch mit uns selbst. Wir befinden uns im Gegenteil des Freiheitszustandes.
Wie genau hält sich die Verfilmung an den Roman?
Ich habe schon versucht, mich möglichst nah an der Geschichte zu bewegen. Andererseits hat ein Roman grundsätzlich andere Strukturen, als es die Dramaturgie eines Filmes erfordert. Deshalb habe ich Parallelen und Ellipsen eingeführt, um der Geschichte eine filmische Struktur zu geben. Zum Beispiel gibt es die zweite Mutter-Tochter-Beziehung im Buch nicht. Aber was die Hauptgeschichte anbelangt, bin ich detailliert am Original geblieben.
Ergibt sich eine andere Sicht auch dadurch, dass der Roman einer Frau von einem Mann verfilmt wurde?
Wenn es so ist, vollzieht es sich außerhalb meiner Kenntnis. Ein Filmemacher wird immer einen anderen Film produzieren als der Autor selbst. Auf das Geschlecht kommt es dabei weniger an.
Wie nah ist das Buch denn Ihrer Meinung nach an den Erfahrungen der Autorin?
An Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen. Elfriede Jelinek selbst macht da widersprüchliche Angaben. Mal hat sie gesagt, es sei ein sehr autobiografisches Buch. Dann wieder fordert sie, den Roman nicht unter diesem Aspekt zu betrachten, weil es die Sache zu sehr einenge. Grundsätzlich ist man dann versucht, etwas als persönliches Problem eines Autors zu sehen. Von ausländischen Journalisten werde ich immer wieder mit Schaudern gefragt, ob denn die Welt in Österreich wirklich so schlecht sei. Damit schiebt man den Film wieder nach Österreich zurück, als hätte man damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt, wenn man alles auf den Autor reduziert. Von mir wird immer behauptet, ich wäre so fasziniert vom Schrecklichen. Mit dem Unterton, ich müsse wohl krank sein. Damit man sich distanziert, sagt man halt, der Regisseur hat ein Problem ? und mit mir hat das nichts zu tun. Ein Mechanismus, der erstaunlich gut funktioniert. Aber so einfach verhält es sich natürlich nicht.
Sind Sie ein Gegner von Filmmusik?
Die Klavierspielerin braucht natürlich Musik, und die Lieder aus Schuberts Winterreise haben einen Bezug zum Geschehen. Insofern hat die Musik hier ihre Berechtigung. In der ersten Hälfte sorgt sie dafür, dass man sich in einem kulturellen Ambiente wohlfühlt. Im zweiten Teil gibt es wenig Musik und auch keinen Grund zum Wohlgefühl. Natürlich ist es eine List, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Auf der anderen Seite war es mir persönlich ein großes Vergnügen, endlich einmal Musik einsetzen zu können. Ich bin ein großer Musikliebhaber, doch in meinen Filmen kann ich sie selten verwenden. Im Kino wird Musik ja gerne dazu benutzt, um die Schwäche der Filme zu kaschieren.
Dienen Sex und Gewalt im Kino auch dazu, Schwierigkeiten zu vertuschen?
Sex und Gewalt werden normalerweise verwendet, um Geschäfte zu machen. Dagegen polemisieren alle meine Filme. Wie ich es mit dem Thema Gewalt in Funny Games getan habe, mache ich es hier mit der Sexualität. Auch Sexualität ist zeigbar, ohne pornografisch zu sein.
Ihr Film löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es gab in Cannes Lacher, Buhrufe und heftigen Applaus. Ist es für Sie wichtig, wie die Leute auf den Film reagieren?
Am liebsten ist es mir, wenn die Leute über meine Filme nachdenken. So möchte ich auch als Zuschauer behandelt werden. Etwas soll sich in Bewegung setzen, damit die zwei Stunden, die ich im Dunkeln verbracht habe, nicht umsonst waren. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute so reagieren, wie es von mir erdacht wurde. Aber in dem Moment, da der Film fertig ist, gehört er nicht mehr mir, sondern dem Publikum. Jeder Zuschauer sieht seinen eigenen Film. Und jeder hat seinen Grund, ihn gut oder schlecht zu finden.
Haben Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Sicher, und ich hoffe doch sehr, dass man das meinen Filmen ansieht. Ich kann doch als Zuschauer nur ein Werk ernst nehmen, wenn ich merke, dass mich der Regisseur respektiert. Was nicht bedeutet, dass ich dem Zuschauer serviere, was er meint, sehen zu wollen. Dann würde ich das machen, was das Fernsehen täglich anrichtet. Mir geht es darum, ihn als Menschen ernst zu nehmen und nicht als Konsumenten zu missbrauchen.
Gehört zum Kino nicht auch der Wunsch, verführen zu wollen?
Mag sein, aber das muss ich ja nicht bedienen. Es gilt, die Eigenständigkeit des Zuschauers zu respektieren. Wenn schon vergewaltigen, dann zur Selbstständigkeit.
Der Regisseur
Michael Haneke, Jahrgang 1942, in München geboren und in Wien aufgewachsen, ist seit 1974 als Regisseur tätig. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit moralisch angehauchten Filmen wie Bennys Video oder Funny Games.
Ein Zitat aus einer Kritik
Wer Bennys Video oder Funny Games gesehen hat, weiß, was einen bei Michael Haneke erwartet: psychologische Entblößungsszenarien, irrationale Gewalt. Dennoch verlässt auch der Hartgesottene das Kino mit weichen Knien. Denn Haneke greift tief in die Abfallgrube menschlicher Gefühle und wirbelt einem das ganze Spektrum (zwischen)menschlichen Horrors um den Kopf. Diesmal sogar ohne moralischen Unterton. Ein Meisterwerk von 130 Minuten, das kein geschmäcklerisches Urteil zulässt.
Dirk Pilz
Die Autorin
Elfriede jelinke wurde am 20.10. 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich geboren. 1970 erschien ihr erster Roman "wir sind lockvögel,baby!", 1983 Die Klavierspielerin, 1984 das Drama "Burgtheater", 1986 erhielt sie den Heinrich-Böll-Preis, 1987 erschien der Roman "Krankheir", 1989 "Lust". Seither sehr viele Romane und Theaterstücke. Derzeit am Wiener Burgtheater die Barbeitung von "Der Jude von Malta" nach Christoper Marlowe. Bekannt auch noch "Gier".
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 17:24:48 mit dem Titel Literatur als Film!
Die Klavierspielerin
Was hat mich bewegt, in diesen Film zu gehen. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Autorin, Michael Haneke ein ebensolcher Regisseur. Seit seiner Verfilmung von "Das Schloß" nach Franz Kafka für mich auch ein Spezialist für Literatur. Grund genug für mich, wieder einmal das Kino zu besuchen. Und dazu zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen Annie Giradot und Isabelle Huppert, da kann mich nichts mehr aufhalten.
Der Inhalt
Der Film, der auf einem gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks (immerhin schon 1983 erschienen) beruht, handelt vom Leben und den Obsessionen der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert), die mit ihrer Mutter (Annie Girardot) in einer engen und beengten Wohnung lebt. Erika wird von ihrer Mutter kontrolliert und tyrannisiert. Die Mutter brachte Erika eigentlich nur aus einem Grund zur Welt - damit ein Genie aus ihr wird, in Erikas Fall eine Klaviervirtuosin. Leider hat es nur zur Klavierlehrerin gereicht, und unter dieser Schande läßt die Mutter Erika leiden. Erika Kohut arbeitet am Wiener Konservatorium und unterrichtet dort die Studenten in der Handhabung des Pianos. Privat ist sie alles andere als selbstständig, denn mit ihren 40 Jahren steht sie noch gewaltig unter dem Pantoffel ihrer Mutter, die sie permanent kontrolliert und wie ein kleines Kind behandelt. Während Erika den ganzen Tag Klavierunterricht gibt, paßt ihre Mutter auf sie (die um die 40 ist) wie auf ein kleines Kind auf.
Erika gönnt sich aber ein spezielles Hobby: sie besucht heimlich Pornokabinen in Sexshops und "begeilt" sich, während sie sich Blow-Jobs (Französische Liebe) betrachtet, an benutzten Papiertaschentüchern, an denen sie riecht, nichts weiter. Ab und zu findet sie auch Lust, wenn sie neben einem kopulierenden Paar im Autokino mit Lust ihr Wasser lässt. Und ab und zu führt sie sich Rasierklingen ein und findet ein masochistisch-erotisches Vergnügen.
Erika weiß genau, was sie tut. Sie will dieses Leben und macht keinerlei Anstalten, ihre Mutter zu verlassen, was sie finanziell durchaus könnte. Aber sie braucht ihre Mutter. Sie braucht den Ärger und Streit mit ihrer Mutter wie sie die gefühllose Kälte benötigt, die sie ihren Klavierschülern entgegenbringt, während sie gleichzeitig genau weiß, wie man Schubert zu spielen hat. Intellekt geht bei ihr immer vor Gefühl.
Nur eine ihrer Schülerinnen, die von deren Mutter mehr oder weniger gezwungen wird, eine "große Pianistin" zu werden, verzweifelt fast an der Rolle, in die sie andere hineinzwängen. Von der Mutter sekkiert und mit Ehrgeiz angestachelt, von Erika gequält, bleibt sie allerdings dennoch beim Klavierspielen.
Dann erscheint der junge Walter Klemmer - schon ein sprechender Name - (Benoît Magimel), der sich in Erika verliebt. Die wiederum scheint ihn anfänglich abzuweisen, doch diese Abweisung ist kalkuliert. Nicht Liebe ist hier im Spiel, sondern Befriedigung ihrer Lebensart auch im sexuellen Bereich: Sie verlangt von Walter in einem furchtbar langen Brief sadistische Behandlung, Knebeln, Fesseln, Schläge. Sie will Opfer sein, so wie sie Täterin ist. Sie lehnt seine Zuneigung ab, wie sie seine Instrumentalisierung begehrt. "Ich habe keine Gefühle", sagt sie zu ihm, "und wenn ich welche habe, dann siegt meine Intelligenz über sie". Ab diesem Zeitpunkt kann Erika all das in die Wirklichkeit projizieren, was sich bislang aus den gesehenen Pornofilmen in ihr aufgestaut hat. Sie lebt förmlich auf. Anfangs ist das Begehren des jungen Mannes gegenüber der erfahrenen Frau noch riesig groß. Aber dann, nachdem Erika ihm klar gemacht hat, daß sie keine Intimität wünscht, sondern reinste sexuelle Befriedigung, was sogar darin gipfelt, dass sie ihm ihren sexuellen Forderungskatalog präsentiert, in dem alles untergebracht ist, was ihre Augen bis dahin an Sexualpraktiken gesehen haben, wandelt sich das Begehren des jungen Mannes in Abscheu.
Erika will Walter für sich benutzen, und dabei ist ihr die genannte Klavierschülerin im Weg, die sie für eine potentielle Gefahr hält. Sie zerbricht ein Glas und schüttet die Scherben in deren Manteltasche. Die Schülerin verletzt sich derart die Hand, daß sie nicht mehr Klavier spielen kann. Der Mutter der Schülerin, die sich unter Tränen bei ihr darüber beklagt, daß ihre ganzen Pläne nun gescheitert seien, hält sie den Spiegel vor: Sie zwinge doch ihre Tochter in diese Rolle der potentiell erfolgreichen Pianisten, ihre Tochter opfere sich schließlich für ihre Pläne.
Walter, zunächst entsetzt über Erikas Brief, hält sie für krank. Doch dann begibt er sich selbst in diese Welt der tragischen Abhängigkeiten: Er lässt sich am Herrenklo des Wiener Konzerthaus schmerzhaft einen "runterholen" und schaut Erika beim Erbrechen zu, während sie mit ihm nach dem Eishockey-Spiel in einer Kabine oral verkehrt. Am Abend kommt Walter in ihre Wohnung, schließt Erikas Mutter ins Wohnzimmer ein und rächt sich: Er schlägt Erika brutal, zwingt sie zum Geschlechtsverkehr und läßt sie blutend am Boden liegen.
Erika, die anstatt ihrer Schülerin beim Abschlusskonzert des Konservatoriums Klavier spielen soll, packt ein langes Küchenmesser in ihre Handtasche. Im Konservatorium wartet sie auf Walter. Als er lachend mit Freunden an ihr vorbeigeht, nimmt sie schweigend das Messer und durchsticht ihre linke Schulter.
Der Film
Er ist ein abstoßend/anziehendes Meisterwerk, eine dichte Erzählung, die einen in keiner Sekunde kalt oder gleichgültig lässt. Schauspielerische Meisterleistungen von Isabelle Huppert als Klavierlehrerin Kohut, die großartig in all ihren abgründigen Gefühlen, soweit man diese denn noch auszumachen in der Lage ist, ist. Ebenso gut Annie Girardot (als Mutter der Huppert), die diese anspannende, manchmal kaum auszuhaltende Stimmung immer wieder bis hin zu herzlichem Lachen erfrischend bricht. Und nicht zu vergessen Benoît Magimel, der jungedhafte und jungenhafte Liebe, Überheblichkeit, Abschau, Zorn meisterhaft auf die Leinwand bringt.
Der Handlung fehlt jede begleitende Musik, nur das Klavierspiel von Lehrerin und Schülern hört man und einmal den Anklang eines Liedes. Das verstärkt den gespenstisch dichten Eindruck.
Beide Darsteller, Isabelle Huppert und Benoit Magimel bekamen für ihre darstellerischen Leistungen übrigens in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Michael Haneke den großen Preis der Jury für die beste Regie.
Die Klavierspielerin
Österreich, Frankreich 2001, 130 Minuten
Regie: Michael Haneke
Hauptdarsteller: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel
Der Regisseur zu seinem Film
Aus Das Heft: Kino
Dorothée Lackner sprach mit Michael Haneke.
Die Klavierspielerin ist eine hochgradig gestörte Frau. Warum gelingt es uns Normalos trotzdem nicht, uns in der Haltung des Voyeurs bequem zurückzulehnen?
Weil es im Hirn weiterarbeitet. Ich benutze ja gern den Ausnahmefall, um das Typische einer Gesellschaft zu zeigen. Am Extrem lässt sich leichter verdeutlichen, was wir als Normalität empfinden. Über eine private Geschichte lässt sich viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen. Allerdings bin ich nicht bereit, meine eigene Arbeit zu interpretieren. Ich zeige, was es zu zeigen gibt. Das ist alles. Es ist Aufgabe des Zuschauers, das zu bewerten.
Ist es also normal, dass wir keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen haben?
Ganz sicher, das ist ja der Gegenstand vieler meiner Filme. Wir haben alle Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Auch mit dem Gespräch mit uns selbst. Wir befinden uns im Gegenteil des Freiheitszustandes.
Wie genau hält sich die Verfilmung an den Roman?
Ich habe schon versucht, mich möglichst nah an der Geschichte zu bewegen. Andererseits hat ein Roman grundsätzlich andere Strukturen, als es die Dramaturgie eines Filmes erfordert. Deshalb habe ich Parallelen und Ellipsen eingeführt, um der Geschichte eine filmische Struktur zu geben. Zum Beispiel gibt es die zweite Mutter-Tochter-Beziehung im Buch nicht. Aber was die Hauptgeschichte anbelangt, bin ich detailliert am Original geblieben.
Ergibt sich eine andere Sicht auch dadurch, dass der Roman einer Frau von einem Mann verfilmt wurde?
Wenn es so ist, vollzieht es sich außerhalb meiner Kenntnis. Ein Filmemacher wird immer einen anderen Film produzieren als der Autor selbst. Auf das Geschlecht kommt es dabei weniger an.
Wie nah ist das Buch denn Ihrer Meinung nach an den Erfahrungen der Autorin?
An Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen. Elfriede Jelinek selbst macht da widersprüchliche Angaben. Mal hat sie gesagt, es sei ein sehr autobiografisches Buch. Dann wieder fordert sie, den Roman nicht unter diesem Aspekt zu betrachten, weil es die Sache zu sehr einenge. Grundsätzlich ist man dann versucht, etwas als persönliches Problem eines Autors zu sehen. Von ausländischen Journalisten werde ich immer wieder mit Schaudern gefragt, ob denn die Welt in Österreich wirklich so schlecht sei. Damit schiebt man den Film wieder nach Österreich zurück, als hätte man damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt, wenn man alles auf den Autor reduziert. Von mir wird immer behauptet, ich wäre so fasziniert vom Schrecklichen. Mit dem Unterton, ich müsse wohl krank sein. Damit man sich distanziert, sagt man halt, der Regisseur hat ein Problem ? und mit mir hat das nichts zu tun. Ein Mechanismus, der erstaunlich gut funktioniert. Aber so einfach verhält es sich natürlich nicht.
Sind Sie ein Gegner von Filmmusik?
Die Klavierspielerin braucht natürlich Musik, und die Lieder aus Schuberts Winterreise haben einen Bezug zum Geschehen. Insofern hat die Musik hier ihre Berechtigung. In der ersten Hälfte sorgt sie dafür, dass man sich in einem kulturellen Ambiente wohlfühlt. Im zweiten Teil gibt es wenig Musik und auch keinen Grund zum Wohlgefühl. Natürlich ist es eine List, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Auf der anderen Seite war es mir persönlich ein großes Vergnügen, endlich einmal Musik einsetzen zu können. Ich bin ein großer Musikliebhaber, doch in meinen Filmen kann ich sie selten verwenden. Im Kino wird Musik ja gerne dazu benutzt, um die Schwäche der Filme zu kaschieren.
Dienen Sex und Gewalt im Kino auch dazu, Schwierigkeiten zu vertuschen?
Sex und Gewalt werden normalerweise verwendet, um Geschäfte zu machen. Dagegen polemisieren alle meine Filme. Wie ich es mit dem Thema Gewalt in Funny Games getan habe, mache ich es hier mit der Sexualität. Auch Sexualität ist zeigbar, ohne pornografisch zu sein.
Ihr Film löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es gab in Cannes Lacher, Buhrufe und heftigen Applaus. Ist es für Sie wichtig, wie die Leute auf den Film reagieren?
Am liebsten ist es mir, wenn die Leute über meine Filme nachdenken. So möchte ich auch als Zuschauer behandelt werden. Etwas soll sich in Bewegung setzen, damit die zwei Stunden, die ich im Dunkeln verbracht habe, nicht umsonst waren. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute so reagieren, wie es von mir erdacht wurde. Aber in dem Moment, da der Film fertig ist, gehört er nicht mehr mir, sondern dem Publikum. Jeder Zuschauer sieht seinen eigenen Film. Und jeder hat seinen Grund, ihn gut oder schlecht zu finden.
Haben Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Sicher, und ich hoffe doch sehr, dass man das meinen Filmen ansieht. Ich kann doch als Zuschauer nur ein Werk ernst nehmen, wenn ich merke, dass mich der Regisseur respektiert. Was nicht bedeutet, dass ich dem Zuschauer serviere, was er meint, sehen zu wollen. Dann würde ich das machen, was das Fernsehen täglich anrichtet. Mir geht es darum, ihn als Menschen ernst zu nehmen und nicht als Konsumenten zu missbrauchen.
Gehört zum Kino nicht auch der Wunsch, verführen zu wollen?
Mag sein, aber das muss ich ja nicht bedienen. Es gilt, die Eigenständigkeit des Zuschauers zu respektieren. Wenn schon vergewaltigen, dann zur Selbstständigkeit.
Der Regisseur
Michael Haneke, Jahrgang 1942, in München geboren und in Wien aufgewachsen, ist seit 1974 als Regisseur tätig. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit moralisch angehauchten Filmen wie Bennys Video oder Funny Games.
Ein Zitat aus einer Kritik
Wer Bennys Video oder Funny Games gesehen hat, weiß, was einen bei Michael Haneke erwartet: psychologische Entblößungsszenarien, irrationale Gewalt. Dennoch verlässt auch der Hartgesottene das Kino mit weichen Knien. Denn Haneke greift tief in die Abfallgrube menschlicher Gefühle und wirbelt einem das ganze Spektrum (zwischen)menschlichen Horrors um den Kopf. Diesmal sogar ohne moralischen Unterton. Ein Meisterwerk von 130 Minuten, das kein geschmäcklerisches Urteil zulässt.
Dirk Pilz
Die Autorin
Elfriede jelinke wurde am 20.10. 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich geboren. 1970 erschien ihr erster Roman "wir sind lockvögel,baby!", 1983 Die Klavierspielerin, 1984 das Drama "Burgtheater", 1986 erhielt sie den Heinrich-Böll-Preis, 1987 erschien der Roman "Krankheir", 1989 "Lust". Seither sehr viele Romane und Theaterstücke. Derzeit am Wiener Burgtheater die Barbeitung von "Der Jude von Malta" nach Christoper Marlowe. Bekannt auch noch "Gier".
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 17:25:04 mit dem Titel Literatur als Film!
Die Klavierspielerin
Was hat mich bewegt, in diesen Film zu gehen. Elfriede Jelinek ist eine faszinierende Autorin, Michael Haneke ein ebensolcher Regisseur. Seit seiner Verfilmung von "Das Schloß" nach Franz Kafka für mich auch ein Spezialist für Literatur. Grund genug für mich, wieder einmal das Kino zu besuchen. Und dazu zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen Annie Giradot und Isabelle Huppert, da kann mich nichts mehr aufhalten.
Der Inhalt
Der Film, der auf einem gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks (immerhin schon 1983 erschienen) beruht, handelt vom Leben und den Obsessionen der Wiener Klavierlehrerin Erika Kohut (Isabelle Huppert), die mit ihrer Mutter (Annie Girardot) in einer engen und beengten Wohnung lebt. Erika wird von ihrer Mutter kontrolliert und tyrannisiert. Die Mutter brachte Erika eigentlich nur aus einem Grund zur Welt - damit ein Genie aus ihr wird, in Erikas Fall eine Klaviervirtuosin. Leider hat es nur zur Klavierlehrerin gereicht, und unter dieser Schande läßt die Mutter Erika leiden. Erika Kohut arbeitet am Wiener Konservatorium und unterrichtet dort die Studenten in der Handhabung des Pianos. Privat ist sie alles andere als selbstständig, denn mit ihren 40 Jahren steht sie noch gewaltig unter dem Pantoffel ihrer Mutter, die sie permanent kontrolliert und wie ein kleines Kind behandelt. Während Erika den ganzen Tag Klavierunterricht gibt, paßt ihre Mutter auf sie (die um die 40 ist) wie auf ein kleines Kind auf.
Erika gönnt sich aber ein spezielles Hobby: sie besucht heimlich Pornokabinen in Sexshops und "begeilt" sich, während sie sich Blow-Jobs (Französische Liebe) betrachtet, an benutzten Papiertaschentüchern, an denen sie riecht, nichts weiter. Ab und zu findet sie auch Lust, wenn sie neben einem kopulierenden Paar im Autokino mit Lust ihr Wasser lässt. Und ab und zu führt sie sich Rasierklingen ein und findet ein masochistisch-erotisches Vergnügen.
Erika weiß genau, was sie tut. Sie will dieses Leben und macht keinerlei Anstalten, ihre Mutter zu verlassen, was sie finanziell durchaus könnte. Aber sie braucht ihre Mutter. Sie braucht den Ärger und Streit mit ihrer Mutter wie sie die gefühllose Kälte benötigt, die sie ihren Klavierschülern entgegenbringt, während sie gleichzeitig genau weiß, wie man Schubert zu spielen hat. Intellekt geht bei ihr immer vor Gefühl.
Nur eine ihrer Schülerinnen, die von deren Mutter mehr oder weniger gezwungen wird, eine "große Pianistin" zu werden, verzweifelt fast an der Rolle, in die sie andere hineinzwängen. Von der Mutter sekkiert und mit Ehrgeiz angestachelt, von Erika gequält, bleibt sie allerdings dennoch beim Klavierspielen.
Dann erscheint der junge Walter Klemmer - schon ein sprechender Name - (Benoît Magimel), der sich in Erika verliebt. Die wiederum scheint ihn anfänglich abzuweisen, doch diese Abweisung ist kalkuliert. Nicht Liebe ist hier im Spiel, sondern Befriedigung ihrer Lebensart auch im sexuellen Bereich: Sie verlangt von Walter in einem furchtbar langen Brief sadistische Behandlung, Knebeln, Fesseln, Schläge. Sie will Opfer sein, so wie sie Täterin ist. Sie lehnt seine Zuneigung ab, wie sie seine Instrumentalisierung begehrt. "Ich habe keine Gefühle", sagt sie zu ihm, "und wenn ich welche habe, dann siegt meine Intelligenz über sie". Ab diesem Zeitpunkt kann Erika all das in die Wirklichkeit projizieren, was sich bislang aus den gesehenen Pornofilmen in ihr aufgestaut hat. Sie lebt förmlich auf. Anfangs ist das Begehren des jungen Mannes gegenüber der erfahrenen Frau noch riesig groß. Aber dann, nachdem Erika ihm klar gemacht hat, daß sie keine Intimität wünscht, sondern reinste sexuelle Befriedigung, was sogar darin gipfelt, dass sie ihm ihren sexuellen Forderungskatalog präsentiert, in dem alles untergebracht ist, was ihre Augen bis dahin an Sexualpraktiken gesehen haben, wandelt sich das Begehren des jungen Mannes in Abscheu.
Erika will Walter für sich benutzen, und dabei ist ihr die genannte Klavierschülerin im Weg, die sie für eine potentielle Gefahr hält. Sie zerbricht ein Glas und schüttet die Scherben in deren Manteltasche. Die Schülerin verletzt sich derart die Hand, daß sie nicht mehr Klavier spielen kann. Der Mutter der Schülerin, die sich unter Tränen bei ihr darüber beklagt, daß ihre ganzen Pläne nun gescheitert seien, hält sie den Spiegel vor: Sie zwinge doch ihre Tochter in diese Rolle der potentiell erfolgreichen Pianisten, ihre Tochter opfere sich schließlich für ihre Pläne.
Walter, zunächst entsetzt über Erikas Brief, hält sie für krank. Doch dann begibt er sich selbst in diese Welt der tragischen Abhängigkeiten: Er lässt sich am Herrenklo des Wiener Konzerthaus schmerzhaft einen "runterholen" und schaut Erika beim Erbrechen zu, während sie mit ihm nach dem Eishockey-Spiel in einer Kabine oral verkehrt. Am Abend kommt Walter in ihre Wohnung, schließt Erikas Mutter ins Wohnzimmer ein und rächt sich: Er schlägt Erika brutal, zwingt sie zum Geschlechtsverkehr und läßt sie blutend am Boden liegen.
Erika, die anstatt ihrer Schülerin beim Abschlusskonzert des Konservatoriums Klavier spielen soll, packt ein langes Küchenmesser in ihre Handtasche. Im Konservatorium wartet sie auf Walter. Als er lachend mit Freunden an ihr vorbeigeht, nimmt sie schweigend das Messer und durchsticht ihre linke Schulter.
Der Film
Er ist ein abstoßend/anziehendes Meisterwerk, eine dichte Erzählung, die einen in keiner Sekunde kalt oder gleichgültig lässt. Schauspielerische Meisterleistungen von Isabelle Huppert als Klavierlehrerin Kohut, die großartig in all ihren abgründigen Gefühlen, soweit man diese denn noch auszumachen in der Lage ist, ist. Ebenso gut Annie Girardot (als Mutter der Huppert), die diese anspannende, manchmal kaum auszuhaltende Stimmung immer wieder bis hin zu herzlichem Lachen erfrischend bricht. Und nicht zu vergessen Benoît Magimel, der jungedhafte und jungenhafte Liebe, Überheblichkeit, Abschau, Zorn meisterhaft auf die Leinwand bringt.
Der Handlung fehlt jede begleitende Musik, nur das Klavierspiel von Lehrerin und Schülern hört man und einmal den Anklang eines Liedes. Das verstärkt den gespenstisch dichten Eindruck.
Beide Darsteller, Isabelle Huppert und Benoit Magimel bekamen für ihre darstellerischen Leistungen übrigens in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Michael Haneke den großen Preis der Jury für die beste Regie.
Die Klavierspielerin
Österreich, Frankreich 2001, 130 Minuten
Regie: Michael Haneke
Hauptdarsteller: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel
Der Regisseur zu seinem Film
Aus Das Heft: Kino
Dorothée Lackner sprach mit Michael Haneke.
Die Klavierspielerin ist eine hochgradig gestörte Frau. Warum gelingt es uns Normalos trotzdem nicht, uns in der Haltung des Voyeurs bequem zurückzulehnen?
Weil es im Hirn weiterarbeitet. Ich benutze ja gern den Ausnahmefall, um das Typische einer Gesellschaft zu zeigen. Am Extrem lässt sich leichter verdeutlichen, was wir als Normalität empfinden. Über eine private Geschichte lässt sich viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagen. Allerdings bin ich nicht bereit, meine eigene Arbeit zu interpretieren. Ich zeige, was es zu zeigen gibt. Das ist alles. Es ist Aufgabe des Zuschauers, das zu bewerten.
Ist es also normal, dass wir keinen Zugang mehr zu unseren Gefühlen haben?
Ganz sicher, das ist ja der Gegenstand vieler meiner Filme. Wir haben alle Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Auch mit dem Gespräch mit uns selbst. Wir befinden uns im Gegenteil des Freiheitszustandes.
Wie genau hält sich die Verfilmung an den Roman?
Ich habe schon versucht, mich möglichst nah an der Geschichte zu bewegen. Andererseits hat ein Roman grundsätzlich andere Strukturen, als es die Dramaturgie eines Filmes erfordert. Deshalb habe ich Parallelen und Ellipsen eingeführt, um der Geschichte eine filmische Struktur zu geben. Zum Beispiel gibt es die zweite Mutter-Tochter-Beziehung im Buch nicht. Aber was die Hauptgeschichte anbelangt, bin ich detailliert am Original geblieben.
Ergibt sich eine andere Sicht auch dadurch, dass der Roman einer Frau von einem Mann verfilmt wurde?
Wenn es so ist, vollzieht es sich außerhalb meiner Kenntnis. Ein Filmemacher wird immer einen anderen Film produzieren als der Autor selbst. Auf das Geschlecht kommt es dabei weniger an.
Wie nah ist das Buch denn Ihrer Meinung nach an den Erfahrungen der Autorin?
An Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen. Elfriede Jelinek selbst macht da widersprüchliche Angaben. Mal hat sie gesagt, es sei ein sehr autobiografisches Buch. Dann wieder fordert sie, den Roman nicht unter diesem Aspekt zu betrachten, weil es die Sache zu sehr einenge. Grundsätzlich ist man dann versucht, etwas als persönliches Problem eines Autors zu sehen. Von ausländischen Journalisten werde ich immer wieder mit Schaudern gefragt, ob denn die Welt in Österreich wirklich so schlecht sei. Damit schiebt man den Film wieder nach Österreich zurück, als hätte man damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt, wenn man alles auf den Autor reduziert. Von mir wird immer behauptet, ich wäre so fasziniert vom Schrecklichen. Mit dem Unterton, ich müsse wohl krank sein. Damit man sich distanziert, sagt man halt, der Regisseur hat ein Problem ? und mit mir hat das nichts zu tun. Ein Mechanismus, der erstaunlich gut funktioniert. Aber so einfach verhält es sich natürlich nicht.
Sind Sie ein Gegner von Filmmusik?
Die Klavierspielerin braucht natürlich Musik, und die Lieder aus Schuberts Winterreise haben einen Bezug zum Geschehen. Insofern hat die Musik hier ihre Berechtigung. In der ersten Hälfte sorgt sie dafür, dass man sich in einem kulturellen Ambiente wohlfühlt. Im zweiten Teil gibt es wenig Musik und auch keinen Grund zum Wohlgefühl. Natürlich ist es eine List, den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Auf der anderen Seite war es mir persönlich ein großes Vergnügen, endlich einmal Musik einsetzen zu können. Ich bin ein großer Musikliebhaber, doch in meinen Filmen kann ich sie selten verwenden. Im Kino wird Musik ja gerne dazu benutzt, um die Schwäche der Filme zu kaschieren.
Dienen Sex und Gewalt im Kino auch dazu, Schwierigkeiten zu vertuschen?
Sex und Gewalt werden normalerweise verwendet, um Geschäfte zu machen. Dagegen polemisieren alle meine Filme. Wie ich es mit dem Thema Gewalt in Funny Games getan habe, mache ich es hier mit der Sexualität. Auch Sexualität ist zeigbar, ohne pornografisch zu sein.
Ihr Film löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es gab in Cannes Lacher, Buhrufe und heftigen Applaus. Ist es für Sie wichtig, wie die Leute auf den Film reagieren?
Am liebsten ist es mir, wenn die Leute über meine Filme nachdenken. So möchte ich auch als Zuschauer behandelt werden. Etwas soll sich in Bewegung setzen, damit die zwei Stunden, die ich im Dunkeln verbracht habe, nicht umsonst waren. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute so reagieren, wie es von mir erdacht wurde. Aber in dem Moment, da der Film fertig ist, gehört er nicht mehr mir, sondern dem Publikum. Jeder Zuschauer sieht seinen eigenen Film. Und jeder hat seinen Grund, ihn gut oder schlecht zu finden.
Haben Sie als Regisseur eine Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Sicher, und ich hoffe doch sehr, dass man das meinen Filmen ansieht. Ich kann doch als Zuschauer nur ein Werk ernst nehmen, wenn ich merke, dass mich der Regisseur respektiert. Was nicht bedeutet, dass ich dem Zuschauer serviere, was er meint, sehen zu wollen. Dann würde ich das machen, was das Fernsehen täglich anrichtet. Mir geht es darum, ihn als Menschen ernst zu nehmen und nicht als Konsumenten zu missbrauchen.
Gehört zum Kino nicht auch der Wunsch, verführen zu wollen?
Mag sein, aber das muss ich ja nicht bedienen. Es gilt, die Eigenständigkeit des Zuschauers zu respektieren. Wenn schon vergewaltigen, dann zur Selbstständigkeit.
Der Regisseur
Michael Haneke, Jahrgang 1942, in München geboren und in Wien aufgewachsen, ist seit 1974 als Regisseur tätig. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit moralisch angehauchten Filmen wie Bennys Video oder Funny Games.
Ein Zitat aus einer Kritik
Wer Bennys Video oder Funny Games gesehen hat, weiß, was einen bei Michael Haneke erwartet: psychologische Entblößungsszenarien, irrationale Gewalt. Dennoch verlässt auch der Hartgesottene das Kino mit weichen Knien. Denn Haneke greift tief in die Abfallgrube menschlicher Gefühle und wirbelt einem das ganze Spektrum (zwischen)menschlichen Horrors um den Kopf. Diesmal sogar ohne moralischen Unterton. Ein Meisterwerk von 130 Minuten, das kein geschmäcklerisches Urteil zulässt.
Dirk Pilz
Die Autorin
Elfriede jelinke wurde am 20.10. 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich geboren. 1970 erschien ihr erster Roman "wir sind lockvögel,baby!", 1983 Die Klavierspielerin, 1984 das Drama "Burgtheater", 1986 erhielt sie den Heinrich-Böll-Preis, 1987 erschien der Roman "Krankheir", 1989 "Lust". Seither sehr viele Romane und Theaterstücke. Derzeit am Wiener Burgtheater die Barbeitung von "Der Jude von Malta" nach Christoper Marlowe. Bekannt auch noch "Gier".
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 18:08:21 mit dem Titel Die fabelhafte Welt der Amélie
Schön langsam entdecke ich wieder meine Liebe zum französischen Film. Nach Chocolat nun in ?Die fabelhafte Welt der Amélie?, wie leider öfters üblich eine völlig unnötig falsche Übersetzung des Originals ?Das fabelhafte Schicksal der Amélie Poulain?, aber dafür hat es schlimmere Beispiele gegeben. Den Regisseur Jean-Pierre Jeunet kannte ich schon von Delicatessen (1991), der Endzeitstimmung über Menschenfresser in einer zerstörten französischen Stadt. Dieser sein neuester Film hat aber mit Endzeit und Tristesse gar nichts zu tun, er ist ein modernes Märchen.
Die Handlung:
Hauptort der Handlung ist Paris. Die Titelrolle Amélie, Angang 20, (gespielt von Audrey Tautou) arbeitet als Kellnerin im Café des Deux Moulins am Montmartre. Sie lebt alleine eine schüchterne junge Frau. In einer Rückblende wird ihre überbehütete Kindheit gezeigt: kein Spielen mit anderen Kindern, aber auch kein liebevolles Gespräch, kein Liebe auch im Elternhaus. Der Vater verschlossen, nur an seiner Arbeit und dem Garten interessiert, die Mutter ebenso schüchtern wie sie. Als die Mutter stirbt, baut der Vater ein Mausoleum im Garten, mit Pflanzen, Steinen und Gartenzwerge, Amélie übersiedelt nach Paris, in eine winzige Wohnung, findet kaum Freunde und beschließt nach unbefriedigenden Sexualerlebnissen auch auf Männer weitestgehend zu verzichten. Sie entdeckt ihre einzige Mission: andere Menschen glücklich machen zu wollen.
Sie stiehlt den Lieblingsgartenzwerg ihres Vaters und schickt diesen mit einer Bekannten auf Weltreise. Von dort bekommt ihr Vater laufend Fotos des Zwerges vor bedeutenden Monumenten, um den Vater zu einer Reise zu überreden. Sie sucht und findet den Besitzer von Kinderspielzeug, das sie in einer verborgenen Mauernische ihrer Wohnung findet, sie schreibt im Namen eines toten Liebesbriefe an einer verlassene Hausbewohnerin und lässt diese dadurch wieder an Liebe glauben, sie lässt Gedichte auf Häuserwände schreiben ... .
Ihre fabelhafte Welt ist ein magischer Ort voll großer Wunder und kleiner Geheimnisse. ?Sie kümmert sich um die Menschen?, weiß ihr Freund, der einsame Maler im Nebenhaus, der seine Wohnung wegen einer schrechlichen Krankheit (Glasknochen, die bei der kleinesten Anstrengung brechen können) seine Wohnung seit 20 Jahren nicht verlassen hat. ?Doch wer kümmert sich um sie??
Nino Quincampoix (gespielt von Mathieu Kassovitz, den man auch als Regisseur kennt) arbeitet als Kassierer in einem Porno-Videoshop, nebenbei als Gespenst in einer Geisterbahn. In seiner Freizeit sammelt er die Fotos, die Menschen vor Fotoautomaten wegwerfen, weil ihnen die Bilder nicht gefallen haben. Dabei ?jagt? er einem geheimnisvollen Fremden hinterher, dessen Fotos er immer wieder bei verschiedenen Automaten findet. Auch dieses Geheimnis wird Amélie letztendlich für ihn lösen. Nino könnte Amélies große Liebe werden. Aber nur wenn alles gut geht. Denn ab und zu hat auch Amélie Pech, den das Schicksal will auch nicht immer so, wie sie will.
Die Schauspieler:
Der Film ist auch die Geburt einer großartigen Schauspielerin, Audrey Tautou. Der Regisseur entdeckte sie auf einem Filmplakat. ?Ich sah ein Paar dunkler Augen, einen Hauch von Unschuld und einen ganz und gar ungewöhnlichen Gesichtsausdruck. Nach zehn Sekunden war mir klar: diese Frau ist perfekt für meinen Film?. Und recht hat er gehabt. In einem durchgängig ganz und gar großartigen Ensemble ist sie der Sztar. Zum Verlieben liebenswert, ganz zart im Ausdruck und immer präsent. Sie allein lohnt schon den Besuch dieses Filmes für die ganze Familie.
Die Empfehlun:
Partner nehmen, Freunde nehmen, Kinder nehmen und anschauen. Ein wenig schmusen und genießen. Einer der besten Filme dieser Saison.
Zuletzt die Fakten:
Die fabelhafte Welt der Amélie (le fabuleux destin d?amélie Poulain)
Frankreich/Deutschland 2001. Regie: Jean-Pierre Jeunet. Produktion: Claudie Ossard. Buch. Gauillaume Laurant, : Jean-Pierre Jeunet. Kamera: Bruno Delbonnel. Schnitt: Hervé Schneid. Musik: Yann Tiersen. Länge: 120 Minuten. Mit Audrey Tautou (Amélie), Mathieu Kassovitz (Nino), Rufus, Yolande Moreau, Artus Penguern, Urbain Cancellier, Dominique Pinon.
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-13 19:37:12 mit dem Titel Ach wie verführerisch...
CHOCOLAR
Jetzt versuche ich mich zum ersten Mal über einen Film. Bin sonst eher ein Theater-Geher. Aber die Vorberichte und die Geschichte haben mich schon sehr interessiert und Juliette Binoche mag ich sehr.
Die Geschichte erzählt das Leben in einem kleinen französischen Dorf, in das eine Schokoladen-Macherin (Juliette Binoche) kommt und es durch ihre ungewöhnliche Lebensweise und Lebensgeschichte gehörig in Aufregung versetzt. Eine Zigeunerin, die das Handwerk über Generationen mitbekommen hat und bis zur Perfektion beherrscht. Sie mischt Chili und Pfefer und allerlei sonstige exotische Gewürze in ihre Süssigkeiten, hat eine uneheliche Tochter und gibt wenig auf Religion und Vorurteile. Das macht sie verdächtig: vor allem in den Augen der Frauen. Die Männer kocht sie mit ihren Leckereien immer mehr ein. Bis auf den Bürgermeister, einen alten Adeligen, den seinen Frau verlassen hat, und der dadurch immer verbitterter wird und jeden Spaß am Leben verloren hat; das verlangt er auch von seinen Mitbürgern.
Als sich die Schokoladenmacherin auch noch in einen Zigeuenr und Theatermacher verliebt (Johnny Depp), bringt sie das Faß zum Überlaufen. Die Boote der Zigeuner werden angezündet, ihre Tochter kommt fast ums Leben. Sie will nichts wie weg. Am Schluß beschließt sie aber, die karriere - immer wieder von Ort zu Ort zu ziehen, zu beenden, bleibt im Ort, Johnny Depp kommt zurück, der Bürgermeister wird entlarvt, bekehrt und alle sind glücklich.
Es ist ein sehr schöner und sensibler Film. Wunderschöne Bilder des ortes, der Natur, der menschen und der Schokoladen - tiefe Einblicke in das Seelenleben von Klein- und Großbürgern. der Mann, der eine Frau seit Jahren liebt und sich ihr nicht zu nähern traut, weil ihre Trauerzeit angeblich nicht zu Ende ist; die bigotte Tochter, die ihre Mutter in ein Heim abschieben will und ihr ihr letztes Glück kurz vor dem Sterben nicht gönnt; der Pfarrer, der sich die Predigten vom Bürgermeister vorschreiben läßt, und seine liberaleren Ansichten nicht zum Durchbruch kommen läßt; man könnte stundenlang erzählen.
Lasse Hallstroem hat einen sehr besinnlichen Film gemacht, der nicht nur von den Hauptdarstellern exzellent gespielt wird. Er macht Freude, rührt teilweise zu Tränen und regt sehr zum Nachdenken über seine eigenen Unzulänglichkeiten an. Actionfans sollten ihn großräumig meiden, alle, die einen sehr guten, sehr anrührenden Film sehen wollen, sollten hineingehen, solange er noch irgendwo gespielt wird.
Achja: wenn auch nicht zum Schmusen, dafür ist er zu gut, aber zum Händchenhalten mit meiner Herzallerliebsten ist er auch bestens geeignet.
28 Bewertungen, 2 Kommentare
-

13.05.2002, 22:19 Uhr von constantin
Bewertung: sehr hilfreichnur die Inhaltsangabe, allgemeine Informationen fehlen
-

13.05.2002, 21:59 Uhr von SVoigt3000
Bewertung: sehr hilfreichSchöne Meinung, bei der ich mich frage, wie die vielen "nützlich"-Bewertungen zustande kommen. CU Stephan
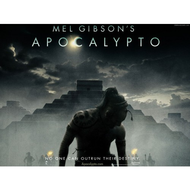
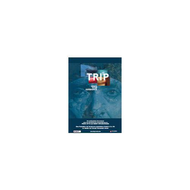


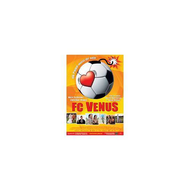
Bewerten / Kommentar schreiben