Erfahrungsbericht von magnifico
Hier wird ein Zeichen gesetzt
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
Anhänger von aufwendig(st)en Spezialeffekten, angefangen bei Spitzenstunts über actiongeladene Kampfszenen bis hin zu leinwanderschütternden Explosionen und Implosionen sollten sowohl auf den Besuch des Films „Signs – Zeichen“ wie auch das weitere Lesen dieses meines Beitrages verzichten, da in beiden Fällen von meiner Seite her nicht für das Ausbleiben einer Enttäuschung garantiert werden kann.
Denn genau das enthält der Film nicht: endlos aneinander gereihte Spezialeffekte – wie sie etwa bei Independence Day, Deep Impact, etc. – zum Einsatz gekommen sind, aufwendige Computersimulationen – hier sei auf Matrix, Star Wars I, II, etc. verwiesen – oder ähnliches, was die meisten heutigen Kinofilme so ausmacht. Vielmehr steht, und das ist eigentlich eine Sensation, die Story, die Schauspieler und... ja, eigentlich noch mehr das im Vordergrund, was eigentlich im Hintergrund eines guten Filmes steht: der Denkansatz, die Vision, die eigene Überlegung. So mag es auch verblüffen, dass der Streifen mit im wesentlichen vier Hauptdarstellern, einigen Nebendarstellern sowie zwei Personen, die sich irgendwo dazwischen befinden, auskommt.
Sicherlich, Mel Gibson verleiht dank seiner schauspielerischen Talente, die hier unumstritten zum Einsatz gekommen und dem Ganzen zum Glanz verholfen haben, eine nicht wegzudenkenden Stellenwert, so dass eben die schauspielerische Leistung mal wieder mehr in Szene gesetzt wird. Dabei meine ich weniger tolle Trickaufnahmen oder anderweitige Aufwertungen, sondern eben einfach nur der Schauspieler – in seiner Rolle? – an sich. Auch die drei anderen Schauspieler, deren Namen, Asche auf mein Haupt, ich leider nicht so ganz in Erinnerung habe, zeichnen sich durch realistische und damit um so nachhaltiger beeindruckende Darbietung aus.
Zunächst, damit vielleicht etwas mehr Verständnis und Klarheit in das Ganze kommt, ein kurzer inhaltlicher Abriss, wobei, keine Sorge, das Ende nicht vorweggenommen wird.
Ausgangspunkt und zugleich beinahe einziger Handlungsort ist eine Maisfarm irgendwo in den USA – Pennsylvania, wenn ich mich nicht so ganz täusche...ist aber letztlich auch irrelevant. Auf ihr leben Greyham, Witwer, Vater zweier Kinder und ehemaliger Pfarrer, sein Bruder, ein Amateur-Baseballstar, sowie seine beiden (kleinen) Kinder.
Die ungetrübte Landidylle, wie sie zunächst für wenige Sekunden zu erblicken ist, wird durch ein Phänomen getrübt, das tatsächlich bereits vor eineinhalb Jahrzehnten die (Fach-)Welt in Aufregung versetzte, jedoch, anders als im Film, derzeit nicht aktuell, zumindest aber nicht nachrichtenfest ist: die Kornkreise.
Bei diesen handelt(e) es sich um geometrische Figuren überdimensionierten Ausmaßes, die vorzugsweise in Korn- oder Maisfeldern aufgetaucht sind, wobei ihre Herkunft, zumindest anfänglich, nicht erklärbar gewesen ist. Theorien wie Außerirdische, mystische Erscheinungen, göttliche Zeichen etc. waren damals gang und gebe.
Eben diese Erscheinungen überschatten auch das bis dahin mehr oder weniger abgeschiedene und isolierte Leben der Kleinfamilie. Während es sich zunächst nur um einen dummen Scherz zu handeln scheint, nehmen weltweit, wie irgendwann auch die Farmbewohner mittels Fernsehen zur Kenntnis nehmen, die Kornkreise zu. Begleitet wird das Ganze von Leuchterscheinungen, die über immer mehr Städten auf der Welt erscheinen und, neu, sich stabilisieren. Ein „Krieg der Welten“ liegt in der Luft und auch die vier auf der Farm, insbesondere die beiden Kinder, nehmen zur Kenntnis, dass tatsächlich eine außerirdische Rasse die Erde aufgesucht hat. Fraglich ist nur, ob in freundlicher oder feindlicher Absicht...
Soweit der Inhalt, der den wesentlichen Kern der ersten Handlungen knapp wiedergeben sollte und zugleich den vordergründigen Rahmen des Films abstecken sollte. Unterlegt wird der Handlungsablauf mit dem nur sukzessive zu Tage tretenden Ereignissen, die der Kinobesucher durch die persönlichen Erinnerungen von Mel Gibson in der Rolle des Familienoberhauptes kennen lernt: den Tod seiner Frau durch ein Verkehrsunglück. Verbunden mit diesem Verlust war für den damaligen Gemeindepfarrer eine Erschütterung seines Glaubens, die ihn zur Abwendung von Gott und der Lossagung seines Pfarreramtes brachte – bis hin zur totalen Verweigerung, die in den Worten „(...) ich werde nicht eine Minute meines Lebens mehr mit beten vergeuden (...)“ ihren Ausdruck findet.
Eine für sich genommen auf den ersten Blick triviale, abgegriffene Handlungsmaterie, bei dem die meisten sicherlich schon das Ende vorweg nehmen glauben zu können. Was sie sicherlich nicht vorwegnehmen können, ist die Umsetzung, die für diesen Teil, aber auch den Rest „drum herum“ gewählt wurde.
Es hat mich sehr beeindruckt, wie die wechselnden Gemütsverfassungen und die Bewältigung der sich stellenden Situationen auf die Leinwand projiziert worden sind. So sirren die Nerven beinahe ab der vierten Minute angesichts der permanent in der Luft liegenden und, in einem auf und ab zu nehmenden, Spannungsmoment, das seinen Höhepunkt zu einem unerwarteten Augenblick findet, abebbt und in noch größerer Stärke erneut zu Tage tritt. Die Gefühle, Anspannungen und Ängste, die von den vier Schauspielern, jeder in seiner Rolle anders und dennoch irgendwie gemeinsam verbunden, wiedergegeben oder, eigentlich zutreffender, dargestellt werden, ist nach meiner Erfahrung selten so gut erreicht worden.
Auch wird auf eine filigrane Weise ein Bündel an scheinbaren Nebensächlichkeiten, auf die näher einzugehen dem Film einen Teil seines Reizes zu nehmen bedeuten würde, am Ende verwoben, während sie am Anfang und noch weit bis in die Mitte des Filmes, soweit man das überhaupt objektiv abschätzen kann, scheinbar sinnlos verstreut sind. Ebenfalls ein starker Ausdruck – ein Zeichen – dafür, dass mit wenigen „Bausteinen“ viel erreicht werden kann.
Dramaturgischer Höhepunkt dürfte bei allem jedoch der Trost sein, den Greyhams Bruder von dem ehemaligen Pfarrer, Greyham, angesichts der zunehmenden Unwissenheit erbittet: so teilen sich die Menschen in zwei Gruppen. Die erste erkennt in glücklichen Zufällen Zeichen, sieht also über das Alltägliche hinaus. Zwar ist sie angesichts der aufgetretenen Ereignisse ratlos und unsicher, was sie zu bedeuten haben, jedoch ahne sie tief in ihrem Innersten, dass es jemanden gebe, der sie beschütze, so dass diese Gruppe keine Angst vor dem Kommenden habe.
Die andere Gruppe nimmt den Zufall als das, was er zu sein scheint: ein bloßer Zufall, sieht also nur das Vordergründige und keinerlei Zeichen. Auch sie kann mit den Ereignissen nichts anfangen, steht ihnen misstrauisch gegenüber und schätzt die Möglichkeit, dass es gut ausgeht, auf 50:50; nur ahnen die Menschen dieser Gruppe tief in ihrem Innersten, dass es niemanden gibt, der sie beschützt, und deshalb fürchten sie sich.
Dieser an sich beinahe biblisch anmutende Trostspruch wird in der Mitte des Films dadurch beinahe konterkariert, dass Greyham auf die Frage seines Bruders, zu welcher Gruppe er gehöre, antwortet: er fürchte sich!
Ich kann den Film all jenen, die ihre Kinobesuche nicht nach den Produktionskosten, den Namen der Mitwirkenden oder dem Sachaufwand planen, nur wärmstens empfehlen, da hier weniger Denkanstösse gegeben werden, sondern vielmehr das, was vielleicht gerade in der heutigen Zeit immer weniger ermöglicht wird: Grenzerfahrungen zu erleiden, zu erdulden, zu verarbeiten. Wer einen nahen Angehörigen oder sonstigen Mitmenschen verloren hat, wird ungleich besser als ich selbst, der ich das nur aus der Phantasie heraus zu beschreiben versuche kann, wissen, wie stark, insbesondere bei Verlusten aufgrund von (Verkehrs-)Unfällen die Zweifel an dem werden, was man so gemein hin mit Glaube an Gott, Gerechtigkeit, Sinn und Zweck um- und beschreibt. Die Leere, die sich ausbreitet, wenn aufgrund eines dummen Zufalls ein Loch in dem bis dahin positiv erlebten Alltag entsteht und die Frage nach dem Warum. Eine universelle Lösung auf diese Frage wird auch dieser Film nicht geben können: Jedoch kann er vielleicht mit der Art, wie hier ein Überwinden des Nichts, der Leere, dargestellt wird, Ansatzpunkt für noch bevorstehende oder schon erlittene und verdrängte Erfahrungen sein. Somit dürfte auch der Besuch dieses Films nicht umsonst oder sinn- und zwecklos sein.
Denn genau das enthält der Film nicht: endlos aneinander gereihte Spezialeffekte – wie sie etwa bei Independence Day, Deep Impact, etc. – zum Einsatz gekommen sind, aufwendige Computersimulationen – hier sei auf Matrix, Star Wars I, II, etc. verwiesen – oder ähnliches, was die meisten heutigen Kinofilme so ausmacht. Vielmehr steht, und das ist eigentlich eine Sensation, die Story, die Schauspieler und... ja, eigentlich noch mehr das im Vordergrund, was eigentlich im Hintergrund eines guten Filmes steht: der Denkansatz, die Vision, die eigene Überlegung. So mag es auch verblüffen, dass der Streifen mit im wesentlichen vier Hauptdarstellern, einigen Nebendarstellern sowie zwei Personen, die sich irgendwo dazwischen befinden, auskommt.
Sicherlich, Mel Gibson verleiht dank seiner schauspielerischen Talente, die hier unumstritten zum Einsatz gekommen und dem Ganzen zum Glanz verholfen haben, eine nicht wegzudenkenden Stellenwert, so dass eben die schauspielerische Leistung mal wieder mehr in Szene gesetzt wird. Dabei meine ich weniger tolle Trickaufnahmen oder anderweitige Aufwertungen, sondern eben einfach nur der Schauspieler – in seiner Rolle? – an sich. Auch die drei anderen Schauspieler, deren Namen, Asche auf mein Haupt, ich leider nicht so ganz in Erinnerung habe, zeichnen sich durch realistische und damit um so nachhaltiger beeindruckende Darbietung aus.
Zunächst, damit vielleicht etwas mehr Verständnis und Klarheit in das Ganze kommt, ein kurzer inhaltlicher Abriss, wobei, keine Sorge, das Ende nicht vorweggenommen wird.
Ausgangspunkt und zugleich beinahe einziger Handlungsort ist eine Maisfarm irgendwo in den USA – Pennsylvania, wenn ich mich nicht so ganz täusche...ist aber letztlich auch irrelevant. Auf ihr leben Greyham, Witwer, Vater zweier Kinder und ehemaliger Pfarrer, sein Bruder, ein Amateur-Baseballstar, sowie seine beiden (kleinen) Kinder.
Die ungetrübte Landidylle, wie sie zunächst für wenige Sekunden zu erblicken ist, wird durch ein Phänomen getrübt, das tatsächlich bereits vor eineinhalb Jahrzehnten die (Fach-)Welt in Aufregung versetzte, jedoch, anders als im Film, derzeit nicht aktuell, zumindest aber nicht nachrichtenfest ist: die Kornkreise.
Bei diesen handelt(e) es sich um geometrische Figuren überdimensionierten Ausmaßes, die vorzugsweise in Korn- oder Maisfeldern aufgetaucht sind, wobei ihre Herkunft, zumindest anfänglich, nicht erklärbar gewesen ist. Theorien wie Außerirdische, mystische Erscheinungen, göttliche Zeichen etc. waren damals gang und gebe.
Eben diese Erscheinungen überschatten auch das bis dahin mehr oder weniger abgeschiedene und isolierte Leben der Kleinfamilie. Während es sich zunächst nur um einen dummen Scherz zu handeln scheint, nehmen weltweit, wie irgendwann auch die Farmbewohner mittels Fernsehen zur Kenntnis nehmen, die Kornkreise zu. Begleitet wird das Ganze von Leuchterscheinungen, die über immer mehr Städten auf der Welt erscheinen und, neu, sich stabilisieren. Ein „Krieg der Welten“ liegt in der Luft und auch die vier auf der Farm, insbesondere die beiden Kinder, nehmen zur Kenntnis, dass tatsächlich eine außerirdische Rasse die Erde aufgesucht hat. Fraglich ist nur, ob in freundlicher oder feindlicher Absicht...
Soweit der Inhalt, der den wesentlichen Kern der ersten Handlungen knapp wiedergeben sollte und zugleich den vordergründigen Rahmen des Films abstecken sollte. Unterlegt wird der Handlungsablauf mit dem nur sukzessive zu Tage tretenden Ereignissen, die der Kinobesucher durch die persönlichen Erinnerungen von Mel Gibson in der Rolle des Familienoberhauptes kennen lernt: den Tod seiner Frau durch ein Verkehrsunglück. Verbunden mit diesem Verlust war für den damaligen Gemeindepfarrer eine Erschütterung seines Glaubens, die ihn zur Abwendung von Gott und der Lossagung seines Pfarreramtes brachte – bis hin zur totalen Verweigerung, die in den Worten „(...) ich werde nicht eine Minute meines Lebens mehr mit beten vergeuden (...)“ ihren Ausdruck findet.
Eine für sich genommen auf den ersten Blick triviale, abgegriffene Handlungsmaterie, bei dem die meisten sicherlich schon das Ende vorweg nehmen glauben zu können. Was sie sicherlich nicht vorwegnehmen können, ist die Umsetzung, die für diesen Teil, aber auch den Rest „drum herum“ gewählt wurde.
Es hat mich sehr beeindruckt, wie die wechselnden Gemütsverfassungen und die Bewältigung der sich stellenden Situationen auf die Leinwand projiziert worden sind. So sirren die Nerven beinahe ab der vierten Minute angesichts der permanent in der Luft liegenden und, in einem auf und ab zu nehmenden, Spannungsmoment, das seinen Höhepunkt zu einem unerwarteten Augenblick findet, abebbt und in noch größerer Stärke erneut zu Tage tritt. Die Gefühle, Anspannungen und Ängste, die von den vier Schauspielern, jeder in seiner Rolle anders und dennoch irgendwie gemeinsam verbunden, wiedergegeben oder, eigentlich zutreffender, dargestellt werden, ist nach meiner Erfahrung selten so gut erreicht worden.
Auch wird auf eine filigrane Weise ein Bündel an scheinbaren Nebensächlichkeiten, auf die näher einzugehen dem Film einen Teil seines Reizes zu nehmen bedeuten würde, am Ende verwoben, während sie am Anfang und noch weit bis in die Mitte des Filmes, soweit man das überhaupt objektiv abschätzen kann, scheinbar sinnlos verstreut sind. Ebenfalls ein starker Ausdruck – ein Zeichen – dafür, dass mit wenigen „Bausteinen“ viel erreicht werden kann.
Dramaturgischer Höhepunkt dürfte bei allem jedoch der Trost sein, den Greyhams Bruder von dem ehemaligen Pfarrer, Greyham, angesichts der zunehmenden Unwissenheit erbittet: so teilen sich die Menschen in zwei Gruppen. Die erste erkennt in glücklichen Zufällen Zeichen, sieht also über das Alltägliche hinaus. Zwar ist sie angesichts der aufgetretenen Ereignisse ratlos und unsicher, was sie zu bedeuten haben, jedoch ahne sie tief in ihrem Innersten, dass es jemanden gebe, der sie beschütze, so dass diese Gruppe keine Angst vor dem Kommenden habe.
Die andere Gruppe nimmt den Zufall als das, was er zu sein scheint: ein bloßer Zufall, sieht also nur das Vordergründige und keinerlei Zeichen. Auch sie kann mit den Ereignissen nichts anfangen, steht ihnen misstrauisch gegenüber und schätzt die Möglichkeit, dass es gut ausgeht, auf 50:50; nur ahnen die Menschen dieser Gruppe tief in ihrem Innersten, dass es niemanden gibt, der sie beschützt, und deshalb fürchten sie sich.
Dieser an sich beinahe biblisch anmutende Trostspruch wird in der Mitte des Films dadurch beinahe konterkariert, dass Greyham auf die Frage seines Bruders, zu welcher Gruppe er gehöre, antwortet: er fürchte sich!
Ich kann den Film all jenen, die ihre Kinobesuche nicht nach den Produktionskosten, den Namen der Mitwirkenden oder dem Sachaufwand planen, nur wärmstens empfehlen, da hier weniger Denkanstösse gegeben werden, sondern vielmehr das, was vielleicht gerade in der heutigen Zeit immer weniger ermöglicht wird: Grenzerfahrungen zu erleiden, zu erdulden, zu verarbeiten. Wer einen nahen Angehörigen oder sonstigen Mitmenschen verloren hat, wird ungleich besser als ich selbst, der ich das nur aus der Phantasie heraus zu beschreiben versuche kann, wissen, wie stark, insbesondere bei Verlusten aufgrund von (Verkehrs-)Unfällen die Zweifel an dem werden, was man so gemein hin mit Glaube an Gott, Gerechtigkeit, Sinn und Zweck um- und beschreibt. Die Leere, die sich ausbreitet, wenn aufgrund eines dummen Zufalls ein Loch in dem bis dahin positiv erlebten Alltag entsteht und die Frage nach dem Warum. Eine universelle Lösung auf diese Frage wird auch dieser Film nicht geben können: Jedoch kann er vielleicht mit der Art, wie hier ein Überwinden des Nichts, der Leere, dargestellt wird, Ansatzpunkt für noch bevorstehende oder schon erlittene und verdrängte Erfahrungen sein. Somit dürfte auch der Besuch dieses Films nicht umsonst oder sinn- und zwecklos sein.
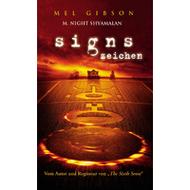
Bewerten / Kommentar schreiben