Erfahrungsbericht von wildheart
Gelungene, intelligente Spider-Man-Verfilmung
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
40 Jahre ist es her, seit Spider-Man sich zum ersten Mal in »Amazing Fantasy #15« durch die Lüfte schwang. In weiteren Filmen konnte man den Spinnenmann zwischen 1977 und 1986 sehen. Nun hat Sam Raimi (»Ein einfacher Plan«, 1998; »For Love of the Game«, 1999; »The Gift«, 2000) den Versuch gestartet, hinter das Geheimnis dieser Ausnahmegestalt unter den Supermännern zu kommen.
Inhalt
Peter Parker (Tobey Maguire, »Pleasantville«, 1998) lebt schon lange als Waise bei Tante May (Rosemary Harris) und Onkel Ben (Cliff Robertson) im New Yorker Stadtteil Queens, ist ein As in der Schule, begeisterter Fotograf und seit Jahren in seine Mitschülerin Mary Jane (Kirsten Dunst) verliebt. Peter ist ein eher unscheinbarer, unauffälliger junger Mann, der von den meisten seiner Mitschüler nicht nur nicht ernst genommen, sondern auch ständig drangsaliert wird. Nur Harry (James Franco), der Sohn des Geschäftsmanns Norman Osborn (Willem Dafoe), ist Peters Freund.
Als Peter mit seiner Klasse ein Forschungslabor besucht, in dem mit Spinnen experimentiert wird, beißt ihn eines der genetisch veränderten Tierchen. Die Folgen sind fatal: Peter verfügt plötzlich über ungeahnte körperliche Kräfte, kann sich wie eine Spinne bewegen und entdeckt, dass er auch wie eine Spinne Netze ziehen kann. Er benötigt keine Brille mehr und hat gewisse hellseherische Fähigkeiten.
Obwohl er sich nichts mehr wünscht, als dass Mary Jane sich in ihn verliebt, geht die mit einem der protzigen Angeber aus der Klasse. Wie gern würde Peter Mary Jane in einem schicken Auto abholen und mit ihr ausgehen. Doch dazu fehlt ihm das nötige Kleingeld. Da liest er in einer Zeitungsanzeige, dass derjenige 3.000 Dollar erhalte, der drei Minuten im Ring gegen einen Super-Wrestler durchhält. Gesagt, getan. Peter verkleidet sich als Spinnenmann, steigt in den Ring und siegt. Allerdings weigert sich der Veranstalter, ihm das wohl verdiente Geld auszuzahlen und will ihn mit 100 Dollar abspeisen. Als Peter enttäuscht das Ringkampfgebäude verlassen will, überfällt ein Einbrecher den Veranstalter und stiehlt das Geld, das eigentlich ihm zusteht. Aber es kommt noch schlimmer: Derselbe Einbrecher überfällt wenig später ein Geschäft und erschießt Onkel Ben. Peter ist verzweifelt, macht sich Vorwürfe, nicht früher an Ort und Stelle gewesen zu sein – und erinnert sich an einen Satz, den Onkel Ben kurz zuvor zu ihm gesagt hatte: »Große Macht bringt große Verantwortung mit sich.« Peter hatte auf dieses Wort seines Onkels abweisend reagiert. Doch jetzt ist er entschlossen, nachdem er den Mörder seines Onkels gestellt hat, künftig mit Hilfe seiner außergewöhnlichen Kräfte dafür zu sorgen, dass das Verbrechen in New York keine Chance mehr hat.
In der Zwischenzeit ist Norman Osborn, der mit seiner Firma für das Militär arbeitet, darum bemüht, seine Firma zu retten. Denn General Slocum (Stanley Anderson) will einem Konkurrenten künftig die Gelder zuschustern, die bisher Osborn für die Entwicklung von Substanzen bekommen hatte, mit Hilfe derer Menschen ungeahnte Kräfte entwickeln sollen. Osborn entschließt sich, eine solche Substanz an sich selbst auszuprobieren. Doch das hat schreckliche Nebenwirkungen: Das Mittel verändert sein Wesen, seine negativen Eigenschaften kommen voll zur Geltung. Er wird aggressiv und gewissenlos. Als die Aufsichtsratsmitglieder seines Unternehmens beschließen, ihn zu entlassen, steht ihm der Sinne nur noch nach einem: Rache. Als grüner Kobold verkleidet tötet er sie während eines Festes auf der Straße und wird zum furchtbaren Monster.
Peter kann als Spider-Man gerade noch verhindern, dass Mary Jane bei dem brutalen Angriff Osborns ums Leben kommt. Der Kampf zwischen Spider-Man und The Green Goblin hat begonnen ...
Inszenierung
Sam Raimi stand bei der Verfilmung des populären Comic-Helden u.a. vor zwei Problemen: Die Aufbereitung von Comic-Figuren oder auch PC-Spiel-Figuren für einen Kinofilm hat zum einen ihre Tücken, wie man etwa an »Lara Croft« sehen konnte. Bleibt der Film zu stark der Vorlage verhaftet, wirkt er aufgesetzt und als misslungene filmische Kopie des PC- oder Comic-Originals. Das Genre Film scheitert am Genre Comic. Zweitens fragt sich, wie Phantasie(figuren) und Realität in Einklang gebracht werden können. Besteht eine zu starke Kluft, Distanz zwischen fiktiven Gestalten und Wirklichkeit, zerfällt die Darstellung, sie bricht in zwei unvermittelte Visualisierungen.
Raimi hat beide Probleme auf meinem Gefühl nach glänzende Weise gelöst. »Spider-Man« ist ein Drama, das in sich geschlossen ist. In beiden Figuren – Spider-Man wie Green Goblin – verbleibt eine enge, innere, wesentliche Verbindung zwischen Außergewöhnlichem und Normalem, eine Verbindung die nie abreißt, nie vollständig gebrochen erscheint. Im Gegenteil: Bei Peter Parker wie Norman Osborn verbleibt trotz Verdopplung in zwei Personen ihre charakterliche Einheit, bei Osborn als fast (aber eben nur fast) schizoid, bei Parker als heimliches, geheim gehaltenes, zurückgehaltenes Begehren, als Konzentrat von Wünschen, vor allem nach der Vereinigung mit Mary Jane und nach körperlicher Stärke in Konkurrenz zu seinen männlichen Mitschülern.
Die charakterliche Zeichnung beider Figuren ist nicht plakativ, gleicht nicht monolithischer Gleichförmigkeit, weil sie in ihrer subjektiven Problematik, inneren Zerrissenheit und Unvollkommenheit glaubwürdig erscheinen – und eben dadurch eindeutig und identifizierbar. Peter kann sich nicht von Anfang an wie eine Spinne bewegen; er muss üben, bevor er seine neuen Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kann. Osborn zerbricht bei dem Versuch seine Firma und sich – nach seinen Maßstäben und Gefühlregungen – als Geschäftsmann und Mensch zu retten. Sein Handeln – verstärkt durch die chemische Substanz –, ist denn auch konsequent: Rache und Mord entsprechen der Logik seines Innersten. Die positiven Seiten seines Wesens wollen sich gegen die Gewissenlosigkeit wehren – vergeblich.
Osborn ist genauso wenig das absolut Böse wie Parker das nur Gute. Nein, so wie Osborn scheitert, weil er sich dem Konzept von Mord und Rache nicht erwehren kann und letztlich dann auch nicht mehr will, scheitert Peter als Peter, nicht als Spider-Man, an seinen eigenen Bedürfnissen. Er handelt als Spider-Man gegen das Verbrechen, gegen das Böse, gegen The Green Goblin, aber immer wenn er handelt, beschwört er neues Unglück herauf, ohne das zu wollen.
Spider-Man ist eine zutiefst tragische Gestalt (fast ein moderner Hamlet), die sich in der Konsequenz gegen die Befriedigung der eigenen Wünsche, vor allem nach der sexuellen und emotionalen Vereinigung mit Mary Jane, entscheidet. Diese Entscheidung ist eine gegen die konkrete Liebe und für die Sicherung der Umstände, unter denen Liebe überhaupt nur möglich erscheint, einer Aufgabe, der Peter als Spider-Man sich verschrieben hat.
In dieser inneren Brüchigkeit manifestiert sich die ganze Tragik eines Helden, der durch seine Heldentaten der Erhaltung einer Welt der Menschlichkeit dienen will und sich dabei – als Peter, als Mensch mit Leib und Seele – selbst verliert. Durch diese Art der Inszenierung gewinnt der Film zugleich etwas Tragisches, was über die Figuren hinausgeht und sich letztlich sogar, wenn auch nicht bösartig oder vollkommen negativ stilisiert, gegen sie kritisch richtet. Ganz am Schluss hängt Peter auf einem Wolkenkratzer an der Fahnenstange: einsam, sich bewusst, dass er als Spider-Man immer in Entscheidungsnöte geraten wird. »Great power means great responsibility.« Nur für Sekunden ist die amerikanische Flagge zu sehen, aber eben nicht in einem pathetisch-patriotischen, falschen Sinn. Kann einzelnen Personen oder Gruppen die Aufgabe zufallen, die Bedingungen für die Möglichkeit eines Lebens in Liebe und Menschlichkeit zu sichern (»Allgemeinwohl«), damit alle anderen dies für sich persönlich verwirklichen können? Eine äußerst deutliche Fragestellung mit ebenso deutlich kritischer Tendenz.
Durch die Feinzeichnung der beiden Figuren, die durch das Spiel von Tobey Maguire und Willem Dafoe überzeugend realisiert wurde, verliert sich der Film nicht in einem Auseinanderklaffen von Fiktion und Realität. Zudem setzt Raimi auf Bilder, die die Vitalität, die Vielfältigkeit, das Rumoren, das Chaos von New York, genauer: Manhattan, in grandioser Art und Weise mit den beiden fliegenden Figuren vereinigt. Wenn Spider-Man sich um St. Patricks Cathedral spinnt, dann sieht das eben nicht so aus, als ob King Kong sich am Empire State Buildung zu schaffen macht. Es ist im Gegenteil: vorstellbar.
Manhattan, das Herz von New York? Und was ist mit Queens? Dort leben Peters Onkel und Tante. Der Bezug zu ihnen und ihren Lebensumständen ist eben auch der Bezug zur Einheit der Stadt und damit des Lebens. Peter vergisst das die ganze Zeit über nicht. Der Held hat hier seine äußerst positiven Seiten, wenn er auf der Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit des Lebens insistiert.
Raimi hat es glücklicherweise vermieden, zu stark auf digitale und andere Spezialeffekte sowie übertriebene Action zu setzen. Manchem mag dies zu wenig sein. Doch dieser sparsame und meinem Gefühl nach effektive Einsatz ist Teil einer gelungenen Mischung aus diesen Effekten, Dialogen und der weitgehend intensiven charakterlichen Feinzeichnung der Figuren. Ich kann mich der daher der verschiedentlich geäußerten Kritik nicht anschließen, wie sie etwa Robert Ebert in der Chicago Sunday Times Anfang Mai geäußert hat: »Spider-Man as he leaps across the rooftops is landing to lightly, rebounding too much like a bouncing ball. He looks like a video game figure, not like a person having an amazing experience« (so nachzulesen in: www.suntimes.com/ebert/ebert_reviews/2002/05/05030.html).
Gerade diese Szenen, wenn Spider-Man sich durch die Lüfte mit Hilfe seiner Spinnenfäden schwingt, halte ich mit für die stärksten Szenen, weil sich in ihnen die Widersprüchlichkeit der Person Peters widerspiegelt. Er kann sich nur insoweit »perfekt« wie eine Spinne bewegen, wie dies einem Menschen mit einigen außergewöhnlichen Fähigkeiten eben möglich ist. Als Spider-Man ist Peter keine Spinne, sondern bewegt sich als Mensch so gut, wie sich ein Mensch eben als Spinne bewegen kann (oder wie man sich das eben vorstellt). Die »Un-Perfektion« dieser Szenen korrespondiert mit der Widersprüchlichkeit der Figur.
Die Brüchigkeit sowohl Peters als Peter als auch Peters als Spider-Man kommt gerade dann plastisch zum Ausdruck, wenn er sich etwa über die Fifth Avenue von Haus zu Haus angelt. Technische Mängel, die sich hier und da in den Spezialeffekten zeigen, waren mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Denn dieser Film lebt von der Intelligenz des Drehbuchs, der Feinzeichnung der Charaktere und vor allem einem ausgezeichneten Tobey Maguire.
Schauspieler
Tobey Maguire spielt einen liebevollen, stillen, traurigen Looser, dem man anmerkt, dass er halb zum Verlierer gemacht wurde, halb sich selbst in diese Position gebracht hat. Doch dieser Verlierer ist keine Negativgestalt, eben nicht nur Looser. Er kann kämpfen, nur anders als seine Mitschüler. Maguire ist geradezu der liebevolle und liebende Peter, der als Spider-Mann immer wieder in schwierige Entscheidungssituationen gerät, in denen er seinem Herzen und seinem Verstand folgt – und wiederum scheitert – fast schon ein Sisyphos . Dieses Scheitern selbst aber, das Maguire durch Mimik und Gestik wundervoll zum Ausdruck bringen kann, ist ebensowenig ausschließlich negativ besetzt. Es ist das Scheitern, das dem Leben inhärent ist wie der Erfolg, zugespitzt in Extremsituationen.
Willem Dafoe kann als »grüner Kobold« in einer beinahe schizoiden Situation eines Mannes überzeugen, der immer deutlicher in den Strudel seiner eigenen seelischen Abgründe stürzt.
Kirsten Dunst spielt ihre Rolle zwischen High-School-Girl und verzweifelter, (vor allem von Männern) enttäuschter Frau warmherzig und hautnah. Die Szene, in der sie Spider-Man küsst, während der mit dem Kopf nach unten an einem seiner Spinnenfäden hängt, ist verblüffend schön.
Fazit
»Spider-Man« – das war für mich der einzige Wermutstropfen – endet mit einem Schuss zu viel Rührseligkeit und Herz & Schmerz. Doch darüber kann man fast hinwegsehen. Denn nicht zuletzt mit der Komik, die besonders in der ersten Stunde gut untergebracht ist, und dem mehr oder weniger deutlichen satirischen Unterton nicht allein in bezug auf die Vorlage, sondern auch auf den eigenen Film gelingt Raimi ein unterhaltsamer, intelligenter und zudem im Hinblick auf die Politik und Gesellschaft (im eigenen Lande) durchaus auch kritischer Blick über die Comic-Vorlage hinaus. Man kann nur hoffen, dass dies im geplanten zweiten Teil, der 2004 in die Kinos kommen soll, so bleibt.
Spider-Man
(Spider-Man)
USA 2002, 121 Minuten
Regie: Sam Raimi
Drehbuch: David Koepp, nach dem Comic von Stan Lee, Steve Ditko
Musik: Danny Elfman
Kamera: Don Burgess
Schnitt: Arthur Coburn, Bob Murawski
Spezialeffekte: –
Hauptdarsteller: Tobey Maguire (Peter Parker / Spider-Man), Willem Dafoe (Norman Osborn / Der grüne Kobold), Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), James Franco (Harry Osborn), Cliff Robertson (Ben Parker), Randy Poffo (Bonesaw McGraw), Rosemary Harris (Tante May), J. K. Simmons (J. Jonah Jameson), Joe Manganiello (Flash Thompson), Jack Betts (Henry Balkan), Gerry Becker (Maximilian Fargas), Bill Nunn (Joseph »Robbie« Robertson), Stanley Anderson (General Slocum), Ron Perkins (Dr. Mendel Stromm), K. K. Dodds (Simkins)
Offizielle Homepage: http://www.spider-man-movie.com/
und http://www.spiderman.sonypictures.com/german
Internet Movie Database: http://us.imdb.com/Title?0145487
© Ulrich Behrens 2002
(dieser Beitrag wurde zuerst in www.ciao.com unter dem Mitgliedsnamen Posdole veröffentlicht)
Inhalt
Peter Parker (Tobey Maguire, »Pleasantville«, 1998) lebt schon lange als Waise bei Tante May (Rosemary Harris) und Onkel Ben (Cliff Robertson) im New Yorker Stadtteil Queens, ist ein As in der Schule, begeisterter Fotograf und seit Jahren in seine Mitschülerin Mary Jane (Kirsten Dunst) verliebt. Peter ist ein eher unscheinbarer, unauffälliger junger Mann, der von den meisten seiner Mitschüler nicht nur nicht ernst genommen, sondern auch ständig drangsaliert wird. Nur Harry (James Franco), der Sohn des Geschäftsmanns Norman Osborn (Willem Dafoe), ist Peters Freund.
Als Peter mit seiner Klasse ein Forschungslabor besucht, in dem mit Spinnen experimentiert wird, beißt ihn eines der genetisch veränderten Tierchen. Die Folgen sind fatal: Peter verfügt plötzlich über ungeahnte körperliche Kräfte, kann sich wie eine Spinne bewegen und entdeckt, dass er auch wie eine Spinne Netze ziehen kann. Er benötigt keine Brille mehr und hat gewisse hellseherische Fähigkeiten.
Obwohl er sich nichts mehr wünscht, als dass Mary Jane sich in ihn verliebt, geht die mit einem der protzigen Angeber aus der Klasse. Wie gern würde Peter Mary Jane in einem schicken Auto abholen und mit ihr ausgehen. Doch dazu fehlt ihm das nötige Kleingeld. Da liest er in einer Zeitungsanzeige, dass derjenige 3.000 Dollar erhalte, der drei Minuten im Ring gegen einen Super-Wrestler durchhält. Gesagt, getan. Peter verkleidet sich als Spinnenmann, steigt in den Ring und siegt. Allerdings weigert sich der Veranstalter, ihm das wohl verdiente Geld auszuzahlen und will ihn mit 100 Dollar abspeisen. Als Peter enttäuscht das Ringkampfgebäude verlassen will, überfällt ein Einbrecher den Veranstalter und stiehlt das Geld, das eigentlich ihm zusteht. Aber es kommt noch schlimmer: Derselbe Einbrecher überfällt wenig später ein Geschäft und erschießt Onkel Ben. Peter ist verzweifelt, macht sich Vorwürfe, nicht früher an Ort und Stelle gewesen zu sein – und erinnert sich an einen Satz, den Onkel Ben kurz zuvor zu ihm gesagt hatte: »Große Macht bringt große Verantwortung mit sich.« Peter hatte auf dieses Wort seines Onkels abweisend reagiert. Doch jetzt ist er entschlossen, nachdem er den Mörder seines Onkels gestellt hat, künftig mit Hilfe seiner außergewöhnlichen Kräfte dafür zu sorgen, dass das Verbrechen in New York keine Chance mehr hat.
In der Zwischenzeit ist Norman Osborn, der mit seiner Firma für das Militär arbeitet, darum bemüht, seine Firma zu retten. Denn General Slocum (Stanley Anderson) will einem Konkurrenten künftig die Gelder zuschustern, die bisher Osborn für die Entwicklung von Substanzen bekommen hatte, mit Hilfe derer Menschen ungeahnte Kräfte entwickeln sollen. Osborn entschließt sich, eine solche Substanz an sich selbst auszuprobieren. Doch das hat schreckliche Nebenwirkungen: Das Mittel verändert sein Wesen, seine negativen Eigenschaften kommen voll zur Geltung. Er wird aggressiv und gewissenlos. Als die Aufsichtsratsmitglieder seines Unternehmens beschließen, ihn zu entlassen, steht ihm der Sinne nur noch nach einem: Rache. Als grüner Kobold verkleidet tötet er sie während eines Festes auf der Straße und wird zum furchtbaren Monster.
Peter kann als Spider-Man gerade noch verhindern, dass Mary Jane bei dem brutalen Angriff Osborns ums Leben kommt. Der Kampf zwischen Spider-Man und The Green Goblin hat begonnen ...
Inszenierung
Sam Raimi stand bei der Verfilmung des populären Comic-Helden u.a. vor zwei Problemen: Die Aufbereitung von Comic-Figuren oder auch PC-Spiel-Figuren für einen Kinofilm hat zum einen ihre Tücken, wie man etwa an »Lara Croft« sehen konnte. Bleibt der Film zu stark der Vorlage verhaftet, wirkt er aufgesetzt und als misslungene filmische Kopie des PC- oder Comic-Originals. Das Genre Film scheitert am Genre Comic. Zweitens fragt sich, wie Phantasie(figuren) und Realität in Einklang gebracht werden können. Besteht eine zu starke Kluft, Distanz zwischen fiktiven Gestalten und Wirklichkeit, zerfällt die Darstellung, sie bricht in zwei unvermittelte Visualisierungen.
Raimi hat beide Probleme auf meinem Gefühl nach glänzende Weise gelöst. »Spider-Man« ist ein Drama, das in sich geschlossen ist. In beiden Figuren – Spider-Man wie Green Goblin – verbleibt eine enge, innere, wesentliche Verbindung zwischen Außergewöhnlichem und Normalem, eine Verbindung die nie abreißt, nie vollständig gebrochen erscheint. Im Gegenteil: Bei Peter Parker wie Norman Osborn verbleibt trotz Verdopplung in zwei Personen ihre charakterliche Einheit, bei Osborn als fast (aber eben nur fast) schizoid, bei Parker als heimliches, geheim gehaltenes, zurückgehaltenes Begehren, als Konzentrat von Wünschen, vor allem nach der Vereinigung mit Mary Jane und nach körperlicher Stärke in Konkurrenz zu seinen männlichen Mitschülern.
Die charakterliche Zeichnung beider Figuren ist nicht plakativ, gleicht nicht monolithischer Gleichförmigkeit, weil sie in ihrer subjektiven Problematik, inneren Zerrissenheit und Unvollkommenheit glaubwürdig erscheinen – und eben dadurch eindeutig und identifizierbar. Peter kann sich nicht von Anfang an wie eine Spinne bewegen; er muss üben, bevor er seine neuen Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kann. Osborn zerbricht bei dem Versuch seine Firma und sich – nach seinen Maßstäben und Gefühlregungen – als Geschäftsmann und Mensch zu retten. Sein Handeln – verstärkt durch die chemische Substanz –, ist denn auch konsequent: Rache und Mord entsprechen der Logik seines Innersten. Die positiven Seiten seines Wesens wollen sich gegen die Gewissenlosigkeit wehren – vergeblich.
Osborn ist genauso wenig das absolut Böse wie Parker das nur Gute. Nein, so wie Osborn scheitert, weil er sich dem Konzept von Mord und Rache nicht erwehren kann und letztlich dann auch nicht mehr will, scheitert Peter als Peter, nicht als Spider-Man, an seinen eigenen Bedürfnissen. Er handelt als Spider-Man gegen das Verbrechen, gegen das Böse, gegen The Green Goblin, aber immer wenn er handelt, beschwört er neues Unglück herauf, ohne das zu wollen.
Spider-Man ist eine zutiefst tragische Gestalt (fast ein moderner Hamlet), die sich in der Konsequenz gegen die Befriedigung der eigenen Wünsche, vor allem nach der sexuellen und emotionalen Vereinigung mit Mary Jane, entscheidet. Diese Entscheidung ist eine gegen die konkrete Liebe und für die Sicherung der Umstände, unter denen Liebe überhaupt nur möglich erscheint, einer Aufgabe, der Peter als Spider-Man sich verschrieben hat.
In dieser inneren Brüchigkeit manifestiert sich die ganze Tragik eines Helden, der durch seine Heldentaten der Erhaltung einer Welt der Menschlichkeit dienen will und sich dabei – als Peter, als Mensch mit Leib und Seele – selbst verliert. Durch diese Art der Inszenierung gewinnt der Film zugleich etwas Tragisches, was über die Figuren hinausgeht und sich letztlich sogar, wenn auch nicht bösartig oder vollkommen negativ stilisiert, gegen sie kritisch richtet. Ganz am Schluss hängt Peter auf einem Wolkenkratzer an der Fahnenstange: einsam, sich bewusst, dass er als Spider-Man immer in Entscheidungsnöte geraten wird. »Great power means great responsibility.« Nur für Sekunden ist die amerikanische Flagge zu sehen, aber eben nicht in einem pathetisch-patriotischen, falschen Sinn. Kann einzelnen Personen oder Gruppen die Aufgabe zufallen, die Bedingungen für die Möglichkeit eines Lebens in Liebe und Menschlichkeit zu sichern (»Allgemeinwohl«), damit alle anderen dies für sich persönlich verwirklichen können? Eine äußerst deutliche Fragestellung mit ebenso deutlich kritischer Tendenz.
Durch die Feinzeichnung der beiden Figuren, die durch das Spiel von Tobey Maguire und Willem Dafoe überzeugend realisiert wurde, verliert sich der Film nicht in einem Auseinanderklaffen von Fiktion und Realität. Zudem setzt Raimi auf Bilder, die die Vitalität, die Vielfältigkeit, das Rumoren, das Chaos von New York, genauer: Manhattan, in grandioser Art und Weise mit den beiden fliegenden Figuren vereinigt. Wenn Spider-Man sich um St. Patricks Cathedral spinnt, dann sieht das eben nicht so aus, als ob King Kong sich am Empire State Buildung zu schaffen macht. Es ist im Gegenteil: vorstellbar.
Manhattan, das Herz von New York? Und was ist mit Queens? Dort leben Peters Onkel und Tante. Der Bezug zu ihnen und ihren Lebensumständen ist eben auch der Bezug zur Einheit der Stadt und damit des Lebens. Peter vergisst das die ganze Zeit über nicht. Der Held hat hier seine äußerst positiven Seiten, wenn er auf der Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit des Lebens insistiert.
Raimi hat es glücklicherweise vermieden, zu stark auf digitale und andere Spezialeffekte sowie übertriebene Action zu setzen. Manchem mag dies zu wenig sein. Doch dieser sparsame und meinem Gefühl nach effektive Einsatz ist Teil einer gelungenen Mischung aus diesen Effekten, Dialogen und der weitgehend intensiven charakterlichen Feinzeichnung der Figuren. Ich kann mich der daher der verschiedentlich geäußerten Kritik nicht anschließen, wie sie etwa Robert Ebert in der Chicago Sunday Times Anfang Mai geäußert hat: »Spider-Man as he leaps across the rooftops is landing to lightly, rebounding too much like a bouncing ball. He looks like a video game figure, not like a person having an amazing experience« (so nachzulesen in: www.suntimes.com/ebert/ebert_reviews/2002/05/05030.html).
Gerade diese Szenen, wenn Spider-Man sich durch die Lüfte mit Hilfe seiner Spinnenfäden schwingt, halte ich mit für die stärksten Szenen, weil sich in ihnen die Widersprüchlichkeit der Person Peters widerspiegelt. Er kann sich nur insoweit »perfekt« wie eine Spinne bewegen, wie dies einem Menschen mit einigen außergewöhnlichen Fähigkeiten eben möglich ist. Als Spider-Man ist Peter keine Spinne, sondern bewegt sich als Mensch so gut, wie sich ein Mensch eben als Spinne bewegen kann (oder wie man sich das eben vorstellt). Die »Un-Perfektion« dieser Szenen korrespondiert mit der Widersprüchlichkeit der Figur.
Die Brüchigkeit sowohl Peters als Peter als auch Peters als Spider-Man kommt gerade dann plastisch zum Ausdruck, wenn er sich etwa über die Fifth Avenue von Haus zu Haus angelt. Technische Mängel, die sich hier und da in den Spezialeffekten zeigen, waren mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Denn dieser Film lebt von der Intelligenz des Drehbuchs, der Feinzeichnung der Charaktere und vor allem einem ausgezeichneten Tobey Maguire.
Schauspieler
Tobey Maguire spielt einen liebevollen, stillen, traurigen Looser, dem man anmerkt, dass er halb zum Verlierer gemacht wurde, halb sich selbst in diese Position gebracht hat. Doch dieser Verlierer ist keine Negativgestalt, eben nicht nur Looser. Er kann kämpfen, nur anders als seine Mitschüler. Maguire ist geradezu der liebevolle und liebende Peter, der als Spider-Mann immer wieder in schwierige Entscheidungssituationen gerät, in denen er seinem Herzen und seinem Verstand folgt – und wiederum scheitert – fast schon ein Sisyphos . Dieses Scheitern selbst aber, das Maguire durch Mimik und Gestik wundervoll zum Ausdruck bringen kann, ist ebensowenig ausschließlich negativ besetzt. Es ist das Scheitern, das dem Leben inhärent ist wie der Erfolg, zugespitzt in Extremsituationen.
Willem Dafoe kann als »grüner Kobold« in einer beinahe schizoiden Situation eines Mannes überzeugen, der immer deutlicher in den Strudel seiner eigenen seelischen Abgründe stürzt.
Kirsten Dunst spielt ihre Rolle zwischen High-School-Girl und verzweifelter, (vor allem von Männern) enttäuschter Frau warmherzig und hautnah. Die Szene, in der sie Spider-Man küsst, während der mit dem Kopf nach unten an einem seiner Spinnenfäden hängt, ist verblüffend schön.
Fazit
»Spider-Man« – das war für mich der einzige Wermutstropfen – endet mit einem Schuss zu viel Rührseligkeit und Herz & Schmerz. Doch darüber kann man fast hinwegsehen. Denn nicht zuletzt mit der Komik, die besonders in der ersten Stunde gut untergebracht ist, und dem mehr oder weniger deutlichen satirischen Unterton nicht allein in bezug auf die Vorlage, sondern auch auf den eigenen Film gelingt Raimi ein unterhaltsamer, intelligenter und zudem im Hinblick auf die Politik und Gesellschaft (im eigenen Lande) durchaus auch kritischer Blick über die Comic-Vorlage hinaus. Man kann nur hoffen, dass dies im geplanten zweiten Teil, der 2004 in die Kinos kommen soll, so bleibt.
Spider-Man
(Spider-Man)
USA 2002, 121 Minuten
Regie: Sam Raimi
Drehbuch: David Koepp, nach dem Comic von Stan Lee, Steve Ditko
Musik: Danny Elfman
Kamera: Don Burgess
Schnitt: Arthur Coburn, Bob Murawski
Spezialeffekte: –
Hauptdarsteller: Tobey Maguire (Peter Parker / Spider-Man), Willem Dafoe (Norman Osborn / Der grüne Kobold), Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), James Franco (Harry Osborn), Cliff Robertson (Ben Parker), Randy Poffo (Bonesaw McGraw), Rosemary Harris (Tante May), J. K. Simmons (J. Jonah Jameson), Joe Manganiello (Flash Thompson), Jack Betts (Henry Balkan), Gerry Becker (Maximilian Fargas), Bill Nunn (Joseph »Robbie« Robertson), Stanley Anderson (General Slocum), Ron Perkins (Dr. Mendel Stromm), K. K. Dodds (Simkins)
Offizielle Homepage: http://www.spider-man-movie.com/
und http://www.spiderman.sonypictures.com/german
Internet Movie Database: http://us.imdb.com/Title?0145487
© Ulrich Behrens 2002
(dieser Beitrag wurde zuerst in www.ciao.com unter dem Mitgliedsnamen Posdole veröffentlicht)
43 Bewertungen, 5 Kommentare
-

12.09.2008, 18:03 Uhr von frankensteins
Bewertung: sehr hilfreichliebe Grüße Werner
-

31.08.2008, 12:43 Uhr von tipsi3
Bewertung: sehr hilfreichLiebe Grüße von tipsi3
-

12.03.2008, 18:20 Uhr von wir_2
Bewertung: sehr hilfreichDer Film gefällt mir auch sehr gut, aber ich finde Tobey Maguire einfach zu -bubig-
-

29.09.2007, 21:21 Uhr von Puenktchen3844
Bewertung: sehr hilfreichEin ausführlicher Bericht. LG
-

14.12.2006, 12:10 Uhr von Sayenna
Bewertung: sehr hilfreichsh & Kuss :-)
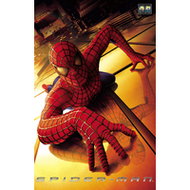
Bewerten / Kommentar schreiben