Erfahrungsbericht von Siana
MS und die Bedeutung der Krankheit für eine Familie
Pro:
fast nichts
Kontra:
fast alles
Empfehlung:
Nein
Ich habe in der Schule eine Arbeit zu diesem Thema geschrieben und möchte diese nun veröffentlichen, weil sehr wenige Leute über MS bescheid wissen. Aber lest selbst:
Inhaltsverzeichnis
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Persönliches Vorwort
1. Einleitung
2. Benennung und Einordnung der Krankheit
2.1. Was ist eine Multiple Sklerose (MS)?
2.2. Die Diagnose
2.3. Wer bekommt MS?
2.4. Der Verlauf
2.5. Was ist ein Schub?
3. Was bedeutet die Krankheit für eine Familie mit einem erkrankten Elternteil?
3.1. Die Partnerschaft
3.1.1. Sexualität
3.1.2. Rollenwechsel
3.1.3. Kinderwunsch
3.1.4. Schuldgefühle und falsche Schonung
3.2. Die Kinder
3.2.1. Geheime Sorgen
3.2.2. Schuldgefühle und Verantwortungsbelastung
3.2.3. Loyalitätskonflikt
3.2.4. Verdrängung
3.2.5. Unterschiede zwischen erkrankter Mutter und erkranktem Vater
3.2.6. Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Geschwistern
3.2.7. Schlussfolgerungen für die Eltern
4. Meine Recherchen
5. Zusammenfassung
Persönliches Schlusswort
Literaturverzeichnis
Persönliches Vorwort
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Erkrankung des mittleren Lebensalters, in der Schweiz gibt es rund 10\'000 Multiple-Sklerose-Betroffene . Trotzdem wissen viele Menschen nichts oder sehr wenig von dieser Krankheit. Das ist einer der beiden Gründe, warum ich für meine Arbeit dieses Thema gewählt habe. Der andere, wohl ausschlaggebendere Grund dafür ist meine MS-kranke Grossmutter. Durch den Einfluss von MS auf meine Familie und mich ist auch die genauere Fragestellung entstanden.
1. Einleitung
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Eine Multiple Sklerose (MS) betrifft nicht nur die an ihr erkrankte Person, sondern auch deren Umfeld, insbesondere die Familie. Um den Umfang des Themas zu einer für diese Arbeit angemessenen Grösse zu verkleinern, werde ich mich im Folgenden jedoch auf Familien mit einem erkrankten Elternteil beschränken. Eine Einführung in das Krankheitsbild ist des Verständnisses wegen nicht zu vermeiden. Danach möchte ich auf die Herausforderungen an die Partnerschaft und an die gesamte Familie eingehen: Welche Probleme bringt eine MS in die Partnerschaft? Kann das Paar sein Sexualleben befriedigend erfahren? Inwiefern wird die Entwicklung der Kinder beeinflusst? Macht es einen Unterschied, ob die Mutter oder der Vater erkrankt ist? Mit welchen Mitteln kann das Zusammenleben einfacher gestaltet werden?
Zum Schluss will ich meine Vorgehensweise in Bezug auf die Erforschung meiner dargestellten Ergebnisse präsentieren.
2. Benennung und Einordnung der Krankheit
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2.1. Was ist eine Multiple Sklerose?
Die Multiple Sklerose (MS) oder auch Enzephalomyelitis disseminata (ED) ist eine bislang nicht heilbare, entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der an verschiedenen (= multiplen) Stellen im Gehirn, an den Sehnerven und im Rückenmark entzündliche Veränderungen der weissen Substanz (Myelin) auftreten, bei deren Rückbildung verhärtete Narben (= Sklerosen), die so genannten Plaques entstehen. Diese stören das Kommunikationssystem des Körpers, wodurch verschiedene Beschwerden auftreten können. Häufigkeit von Beschwerden im Verlauf einer MS (nach Scheinberg und Smith) :
Gang- und Gleichgewichtsstörungen 78 %
Gefühlsstörungen 71 %
Verstärkte Ermüdung 65 %
Schwäche in beiden Beinen 62 %
Störungen beim Wasserlassen 62 %
Störungen beim Geschlechtsverkehr 60 %
Sehminderung eines Auges 55 %
Schwäche eines Armes oder Beines 52 %
Koordinationsstörung der Arme oder Beine 45 %
Schmerzen 25 %
Doppelbilder 43 %
Schwäche der Gesichtsmuskulatur 15 %
Epileptische Anfälle 5 %
Hörstörung 4 %
Trigeminusneuralgie 2 %
2.2. Die Diagnose
Eine MS ist oft nicht leicht festzustellen. Da sich die Anfangsbeschwerden meist schnell wieder zurück bilden, dauert es manchmal Jahre, bis die erkrankten Personen überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin aufsucht. Für diese ist es aufgrund ihrer öfter bestehenden Unwissenheit und der Ähnlichkeit vieler anderer Krankheiten mit MS wiederum oft erst nach Jahren möglich dem Patienten die Diagnose zu stellen, welche jedoch zu Lebzeiten eigentlich nie hundertprozentig sicher ist. Dies ist meist eine grosse Belastung für die Betroffenen und ihre Familien.
2.3. Wer bekommt MS?
Die Ursache ist bislang noch unbekannt. MS ist zwar keine Erbkrankheit im engeren Sinne, das Erkrankungsrisiko steigt aber innerhalb der Familie. Dies wird bei eineiigen Zwillingen auf 25-30 %, bei Geschwistern auf 4 % und bei einem Kind eines oder einer MS-Betroffenen auf 2 % geschätzt. Man vermutet deshalb, dass sowohl genetische Faktoren wie auch Einflüsse aus der Umwelt eine Rolle spielen. Bekannt ist, dass MS bevorzugt im frühen und mittleren Erwachsenenalter auftritt und Frauen etwa doppelt so häufig betrifft wie Männer. Auch tritt MS aus ebenfalls unbekannten Gründen in gemässigten Klimazonen besonders der nördlichen Hemisphäre in Höhe des 40. bis 60. Breitengrades häufiger auf.
2.4. Der Verlauf
Man unterscheidet zwischen der gutartigen, benignen MS (10 % der Fälle) und der bösartigen, malignen Verlaufsform. Gutartig nennt man einen Verlauf, wenn der Patient oder die Patientin 15 Jahre nach Beginn der Erkrankung noch ohne wesentliche Einschränkung im Alltag voll aktiv sein kann. Weiter gibt es drei verschiedene Verlaufsformen:
- schubförmig oder rezidivierend-remittierende MS: Es kommt zu Schüben, die sich anfangs vollständig, später nur noch teilweise zurückbilden.
- sekundär-fortschreitende oder sekundär-progrediente MS: Die schubförmige MS entwickelt sich innerhalb von 10 – 15 Jahren zu einer chronisch fortschreitenden MS.
- primär fortschreitende oder primär progrediente MS: Verläuft mit stetiger Zunahme der Beschwerden mit oder ohne sich vollständig zurückbildenden Schüben.
Kennzeichnend für die Krankheit ist, dass es so gut wie unmöglich ist, den Verlauf sowie die zu erwartenden Beschwerden vorauszusagen. Dies ist für die Einstellung auf die Krankheit und die Zukunftsplanung der Erkrankten und ihrer Familien sehr schwer.
2.5. Was ist ein Schub?
Von einem Schub spricht man, wenn Krankheitszeichen wiederholt auftreten, sich vorhandene verstärken oder länger als 24 Stunden andauern. Die Beschwerden gehen meist komplett zurück, können aber auch teilweise oder ganz bestehen bleiben. Ein Schub tritt eigentlich nie plötzlich auf, sondern entwickelt sich langsam während Tagen oder Wochen. Der Abstand zwischen zwei Schüben beträgt generell mindestens einen Monat. Die Abgrenzung gegenüber kurz dauernden Verschlimmerungen, z. B. nach starken Belastungen, kann wegen der zum Teil fliessenden Übergänge schwierig sein. Die Ursachen und Auslöser von Schüben sind nicht bekannt, weshalb die Betroffenen und die Angehörigen oft in ständiger Angst vor einem neuen Schub leben müssen.
3. Was bedeutet die Krankheit für eine Familie mit einem erkrankten Elternteil?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3.1. Die Partnerschaft
Die meisten Paare trennen sich entweder durch den Einfluss von MS oder aber entwickeln einen stärkeren Zusammenhalt als ihn die meisten anderen haben. Dennoch können Probleme entstehen:
3.1.1. Sexualität
Bis zu 90 % der Männer und 80 % der Frauen mit MS leiden unter sexuellen Schwierigkeiten, was zu einer Einschränkung des Selbstwertgefühls und des Wohlbefindens führen kann. Frauen können von Symptomen wie verminderte Empfindung im Bereich der Scheide und der Klitoris, Trockenheit der Scheide, Libidoverlust oder der Schwierigkeit, einen Orgasmus zu erreichen, betroffen sein.
Bei Männern können Symptome wie Störung oder Verlust der Erektionsfähigkeit und des Ejakulationsvermögens, verringerte Empfindung im Glied sowie Libidoverlust auftreten.
Auch andere Symptome der MS wie Müdigkeit, Spastik in den Beinen oder Stuhl- und Harninkontinenz können empfindlich stören.
Wichtig ist, dass die Paare offen darüber reden. Auch können manche Störungen wirksam behandelt werden. Gegebenenfalls müssen neue Formen von Zärtlichkeit, körperlicher Nähe und Befriedigung entdeckt werden.
3.1.2. Rollenwechsel
Wegen der Unvorhersagbarkeit des Verlaufes leben die Paare in ständiger Bereitschaft Veränderungen zu akzeptieren und Pläne zu verändern. Die erkrankte Person kann Hausmann oder Hausfrau werden und die gesunde muss eventuell neben dem Beruf Aufgaben im Haushalt und in der Kinderbetreuung übernehmen. Der Alltag und der Lebensstil müssen auf die Betroffenen abgestimmt werden.
Paare, die wegen MS die Verantwortungsbereiche neu untereinander aufgeteilt haben, erachten folgende Punkte für das Zusammenleben in der Familie als wichtig:
- Alle zur Verfügung stehenden Mittel sollten eingesetzt werden, um den Alltag möglichst leicht zu gestalten (z. B. Hilfsmittel für das Haus).
- Die von der MS betroffene Person sollte sich offen mit dem Verlust ihrer Selbstständigkeit auseinandersetzen und ihn nicht verleugnen.
- Sie sollte sich ärztliche und psychosoziale Hilfe bei Fachleuten holen, um sich besser mit der Krankheit auseinandersetzen zu können.
- Der Partner oder die Partnerin darf sich selbst nicht vergessen und sollte ausreichend Aktivitäten ausserhalb der Familie wahrnehmen.
- Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familienangehörigen sollten anerkannt und der Alltag danach ausgerichtet werden.
3.1.3. Kinderwunsch
Prinzipiell bestehen für eine MS-kranke Frau keine Einwände schwanger zu werden. Es scheint sogar, dass der Verlauf der MS während der Schwangerschaft positiv beeinflusst wird. Den Partnern sollte aber klar sein, wie sie das Kind in einer schweren Krankheitsphase versorgen. Auch sollte eine Schwangerschaft nur in einer stabilen Krankheitsphase geplant werden. Bei Einnahme von Medikamenten muss mit dem Arzt oder der Ärztin abgeklärt werden, ob diese einen Einfluss auf die Schwangerschaft oder die Muttermilch haben können.
3.1.4. Schuldgefühle und falsche Schonung
Die gesunde Person hat oft Schuldgefühle, wenn sie Dinge tut, die der andern durch deren Krankheit verwehrt sind. Auch behandelt sie sie oft mit viel Rücksicht und schont sie zu sehr. Der oder die Betroffene möchte jedoch keine Sonderbehandlung und kann sich schnell unwohl und bevormundet fühlen. Auch diese Probleme lassen sich mit offenem Reden meist klären.
3.2. Die Kinder
3.2.1. Geheime Sorgen
Die meisten Kinder schildern ihren Alltag zunächst als “ganz normalen” Kinderalltag. Die MS beschreiben sie eher distanziert und unbeteiligt. Dieses harmlose Bild kommt jedoch durch ihre Anstrengungen zustande, sich den Eltern gegenüber möglichst loyal zu verhalten, die gemeinsame Last leichter zu machen und über möglichst lange Zeit hinweg ein “normales” Familienleben zu führen.
Die meisten Kinder befinden sich in einer verunsicherten Grundstimmung, einige davon leben auch in grösserer Angst und Ungewissheit. Insgeheim beobachten sie die Erkrankung des betroffenen Elternteils und stellen Überlegungen zum weiteren Verlauf oder zu möglichen Ansteckungsgefahren an.
Vor allem jüngere Kinder haben oft Angst, Vater oder Mutter könnten sterben und sie würden allein gelassen. Die Eltern sollten ihnen versichern, dass dies nicht so ist.
3.2.2. Schuldgefühle und Verantwortungsbelastung
Die Kinder kommen manchmal zu dem Schluss, dass sie an der Erkrankung der Eltern schuld sein könnten. Dieses Schuldgefühl muss stets bekämpft werden. Auch übernehmen sie in ihrem Drängen nach Unterstützung oft Verantwortung, der sie nicht gewachsen sind und die sich sehr belastend auswirkt. Es ist die Aufgabe der Eltern dies zu verhindern.
3.2.3. Loyalitätskonflikt
Die wenigsten Kinder reagieren auf die Krankheit durch Distanzierung. Eher versuchen sie den Eltern zu helfen und geraten dadurch oft in einen Loyalitätskonflikt zwischen dem “schwachen” betroffenen und dem “überforderten” nichtbetroffenen Elternteil. Sie versuchen beide Seiten zu unterstützen. In einigen Fällen teilen die Geschwister die Aufgabe, der einen oder anderen Seite Unterstützung zu geben, untereinander auf.
3.2.4. Verdrängung
Manche Kinder verdrängen die Krankheit und ihre Sorgen und Ängste. Sie bemühen sich ein möglichst “normales” Bild des Familienlebens aufrecht zu erhalten. MS ist für sie ein Tabu-Thema, auch wenn es vom Rest der Familie nicht so verstanden wird. Manche Kinder sagen auch, ihre Mutter oder ihr Vater sei gar nicht krank.
3.2.5. Unterschiede zwischen erkrankter Mutter und erkranktem Vater
Die Mütter, ob MS-betroffen oder nicht, werden von einigen Kindern als abwesend oder beschäftigt geschildert, während die Schwäche der erkrankten Väter vor allem von ihren Söhnen als kränkend erlebt wird. Väter in der Rolle des nichtbetroffenen Partners werden als hilflos oder überfordert beschrieben.
3.2.6. Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Geschwistern
Bei den ältesten oder zweitältesten Kindern wird der Wunsch nach Umsorgung und Verwöhnung deutlicher. Vor allem in Familien, in denen Unklarheiten bezüglich der Rollenverteilung und der elterlichen Verantwortung bestehen, übernehmen die älteren Geschwister manchmal die Mutter- oder Vaterrolle.
Die jüngsten Kinder leisten ihren Beitrag zur Normalisierung der Familie, indem sie Harmonie, kindliche Unwissenheit und Sorglosigkeit sowie Hilflosigkeit verkörpern. Während die älteren Kinder schnell selbstständig werden, können die Eltern bei den jüngsten Kindern ihre Elternfunktion gut wahrnehmen.
3.2.7. Schlussfolgerungen für die Eltern
Betroffene Familien erklären folgende Dinge für die Entwicklung der Kinder als wichtig:
- klare Strukturen schaffen: Unklarheit und Uneindeutigkeit sollten vermieden, Informationen nicht aus falscher Rücksichtsnahme vorenthalten werden.
- Hauptverantwortung auf der Elternebene belassen: Dem Bedürfnis der Kinder zu helfen, sollte mit klaren Aufgaben nachgekommen werden. Sie dürfen jedoch nicht mit zu viel Verantwortung belastet werden.
- Freiräume für alle schaffen: Jedes Familienmitglied sollte soziale Kontakte nach aussen pflegen, aber auch in der Familie sollten krankheitsunabhängige Erlebnisse stattfinden.
4. Meine Recherchen
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Neben den Informationen aus den Büchern und dem Internet habe ich mich als Angehörige in einem Forum für MS-Betroffene und deren Angehörige angemeldet. Dort finden Diskussionen über jeden Aspekt der Krankheit statt. Ich startete einige Umfragen und Diskussionen und kommunizierte auch über Emails mit Betroffenen, die mich alle freundlich unterstützten.
5. Zusammenfassung
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Eine Krankheit wie MS bringt Komplikationen in das Familienleben, die sich vor allem durch offenes und ehrliches Reden vereinfachen können. Sie lässt die Betroffenen aber auch selbstständiger und für Veränderungen offener werden und ein neues Verständnis für viele Dinge entwickeln.
Persönliches Schlusswort
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ich bin als Enkelin nicht in gleicher Weise und Stärke betroffen, erlebe aber trotzdem einige Aspekte der Krankheit. Das intensive Befassen mit dem Thema und der Austausch mit anderen Angehörigen hat mir und meinem in letzter Zeit auftretenden Bedürfnis nach Auseinandersetzung auf jeden Fall gut getan.
Literaturverzeichnis
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bücher:
- Bischof, K. & Beer, S. (1999). Auch kleine Schritte führen weiter, Multiple Sklerose – die unfassbare Krankheit (1. Aufl.). Zürich: Haffmans Sachbuch.
- Dr. med. Krämer, G. & Prof. Dr. med. Besser, R. (1997). Multiple Sklerose: Antworten auf die häufigsten Fragen: Hilfreiche Erstinformationen für Betroffene und Interessierte (3. Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Papst, J., Dinkel-Sieber, S., Knobel, J. & Rauber, J. (1998). Forschungsprojekt “Kinder in Familien mit einem chronisch kranken Elternteil am Beispiel der Multiplen Sklerose”, Ergebnisse (1. Aufl.). Zürich: SMSG.
Internet:
- Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. (1990). Gefunden am 1. Februar 2003 unter www.dmsg.de
- HaMSter - Deutsche Multiple Sklerose Selbsthilfe e.V. (2002). Gefunden am 11. Februar 2003 unter www.hdmss.de
- Informationen über Multiple Sklerose, eine private Initiative zum Thema MS. (2000). Gefunden am 7. Februar 2003 unter www.muskl.de
- Leben mit MS. (2002). Gefunden am 11. Februar 2003 unter www.leben-mit-ms.de
- MS life. (2002). Gefunden am 15. April 2003 unter www.ms-life.de
- Multiple Sklerose Chat. (1998). Gefunden am 7. Februar 2003 unter www.multiplesklerosechat.de
- Multiple Sklerose Webring. (2001). Gefunden am 7. Februar 2003 unter www.ms-webring.de
- multiple sklerosis international federation: World of Multiple Sklerosis. (1996). Gefunden am 9. März 2003 unter www.msif.org/de/
- Schweizer Multiple Sklerose Gesellschaft. (nicht eruierbar). Gefunden am 1. Februar 2003 unter www.multiplesklerose.ch
Vielen Dank fürs lesen und für Kommentare. Fragen beantworte ich gerne!
Siana
Inhaltsverzeichnis
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Persönliches Vorwort
1. Einleitung
2. Benennung und Einordnung der Krankheit
2.1. Was ist eine Multiple Sklerose (MS)?
2.2. Die Diagnose
2.3. Wer bekommt MS?
2.4. Der Verlauf
2.5. Was ist ein Schub?
3. Was bedeutet die Krankheit für eine Familie mit einem erkrankten Elternteil?
3.1. Die Partnerschaft
3.1.1. Sexualität
3.1.2. Rollenwechsel
3.1.3. Kinderwunsch
3.1.4. Schuldgefühle und falsche Schonung
3.2. Die Kinder
3.2.1. Geheime Sorgen
3.2.2. Schuldgefühle und Verantwortungsbelastung
3.2.3. Loyalitätskonflikt
3.2.4. Verdrängung
3.2.5. Unterschiede zwischen erkrankter Mutter und erkranktem Vater
3.2.6. Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Geschwistern
3.2.7. Schlussfolgerungen für die Eltern
4. Meine Recherchen
5. Zusammenfassung
Persönliches Schlusswort
Literaturverzeichnis
Persönliches Vorwort
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Erkrankung des mittleren Lebensalters, in der Schweiz gibt es rund 10\'000 Multiple-Sklerose-Betroffene . Trotzdem wissen viele Menschen nichts oder sehr wenig von dieser Krankheit. Das ist einer der beiden Gründe, warum ich für meine Arbeit dieses Thema gewählt habe. Der andere, wohl ausschlaggebendere Grund dafür ist meine MS-kranke Grossmutter. Durch den Einfluss von MS auf meine Familie und mich ist auch die genauere Fragestellung entstanden.
1. Einleitung
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Eine Multiple Sklerose (MS) betrifft nicht nur die an ihr erkrankte Person, sondern auch deren Umfeld, insbesondere die Familie. Um den Umfang des Themas zu einer für diese Arbeit angemessenen Grösse zu verkleinern, werde ich mich im Folgenden jedoch auf Familien mit einem erkrankten Elternteil beschränken. Eine Einführung in das Krankheitsbild ist des Verständnisses wegen nicht zu vermeiden. Danach möchte ich auf die Herausforderungen an die Partnerschaft und an die gesamte Familie eingehen: Welche Probleme bringt eine MS in die Partnerschaft? Kann das Paar sein Sexualleben befriedigend erfahren? Inwiefern wird die Entwicklung der Kinder beeinflusst? Macht es einen Unterschied, ob die Mutter oder der Vater erkrankt ist? Mit welchen Mitteln kann das Zusammenleben einfacher gestaltet werden?
Zum Schluss will ich meine Vorgehensweise in Bezug auf die Erforschung meiner dargestellten Ergebnisse präsentieren.
2. Benennung und Einordnung der Krankheit
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2.1. Was ist eine Multiple Sklerose?
Die Multiple Sklerose (MS) oder auch Enzephalomyelitis disseminata (ED) ist eine bislang nicht heilbare, entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der an verschiedenen (= multiplen) Stellen im Gehirn, an den Sehnerven und im Rückenmark entzündliche Veränderungen der weissen Substanz (Myelin) auftreten, bei deren Rückbildung verhärtete Narben (= Sklerosen), die so genannten Plaques entstehen. Diese stören das Kommunikationssystem des Körpers, wodurch verschiedene Beschwerden auftreten können. Häufigkeit von Beschwerden im Verlauf einer MS (nach Scheinberg und Smith) :
Gang- und Gleichgewichtsstörungen 78 %
Gefühlsstörungen 71 %
Verstärkte Ermüdung 65 %
Schwäche in beiden Beinen 62 %
Störungen beim Wasserlassen 62 %
Störungen beim Geschlechtsverkehr 60 %
Sehminderung eines Auges 55 %
Schwäche eines Armes oder Beines 52 %
Koordinationsstörung der Arme oder Beine 45 %
Schmerzen 25 %
Doppelbilder 43 %
Schwäche der Gesichtsmuskulatur 15 %
Epileptische Anfälle 5 %
Hörstörung 4 %
Trigeminusneuralgie 2 %
2.2. Die Diagnose
Eine MS ist oft nicht leicht festzustellen. Da sich die Anfangsbeschwerden meist schnell wieder zurück bilden, dauert es manchmal Jahre, bis die erkrankten Personen überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin aufsucht. Für diese ist es aufgrund ihrer öfter bestehenden Unwissenheit und der Ähnlichkeit vieler anderer Krankheiten mit MS wiederum oft erst nach Jahren möglich dem Patienten die Diagnose zu stellen, welche jedoch zu Lebzeiten eigentlich nie hundertprozentig sicher ist. Dies ist meist eine grosse Belastung für die Betroffenen und ihre Familien.
2.3. Wer bekommt MS?
Die Ursache ist bislang noch unbekannt. MS ist zwar keine Erbkrankheit im engeren Sinne, das Erkrankungsrisiko steigt aber innerhalb der Familie. Dies wird bei eineiigen Zwillingen auf 25-30 %, bei Geschwistern auf 4 % und bei einem Kind eines oder einer MS-Betroffenen auf 2 % geschätzt. Man vermutet deshalb, dass sowohl genetische Faktoren wie auch Einflüsse aus der Umwelt eine Rolle spielen. Bekannt ist, dass MS bevorzugt im frühen und mittleren Erwachsenenalter auftritt und Frauen etwa doppelt so häufig betrifft wie Männer. Auch tritt MS aus ebenfalls unbekannten Gründen in gemässigten Klimazonen besonders der nördlichen Hemisphäre in Höhe des 40. bis 60. Breitengrades häufiger auf.
2.4. Der Verlauf
Man unterscheidet zwischen der gutartigen, benignen MS (10 % der Fälle) und der bösartigen, malignen Verlaufsform. Gutartig nennt man einen Verlauf, wenn der Patient oder die Patientin 15 Jahre nach Beginn der Erkrankung noch ohne wesentliche Einschränkung im Alltag voll aktiv sein kann. Weiter gibt es drei verschiedene Verlaufsformen:
- schubförmig oder rezidivierend-remittierende MS: Es kommt zu Schüben, die sich anfangs vollständig, später nur noch teilweise zurückbilden.
- sekundär-fortschreitende oder sekundär-progrediente MS: Die schubförmige MS entwickelt sich innerhalb von 10 – 15 Jahren zu einer chronisch fortschreitenden MS.
- primär fortschreitende oder primär progrediente MS: Verläuft mit stetiger Zunahme der Beschwerden mit oder ohne sich vollständig zurückbildenden Schüben.
Kennzeichnend für die Krankheit ist, dass es so gut wie unmöglich ist, den Verlauf sowie die zu erwartenden Beschwerden vorauszusagen. Dies ist für die Einstellung auf die Krankheit und die Zukunftsplanung der Erkrankten und ihrer Familien sehr schwer.
2.5. Was ist ein Schub?
Von einem Schub spricht man, wenn Krankheitszeichen wiederholt auftreten, sich vorhandene verstärken oder länger als 24 Stunden andauern. Die Beschwerden gehen meist komplett zurück, können aber auch teilweise oder ganz bestehen bleiben. Ein Schub tritt eigentlich nie plötzlich auf, sondern entwickelt sich langsam während Tagen oder Wochen. Der Abstand zwischen zwei Schüben beträgt generell mindestens einen Monat. Die Abgrenzung gegenüber kurz dauernden Verschlimmerungen, z. B. nach starken Belastungen, kann wegen der zum Teil fliessenden Übergänge schwierig sein. Die Ursachen und Auslöser von Schüben sind nicht bekannt, weshalb die Betroffenen und die Angehörigen oft in ständiger Angst vor einem neuen Schub leben müssen.
3. Was bedeutet die Krankheit für eine Familie mit einem erkrankten Elternteil?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3.1. Die Partnerschaft
Die meisten Paare trennen sich entweder durch den Einfluss von MS oder aber entwickeln einen stärkeren Zusammenhalt als ihn die meisten anderen haben. Dennoch können Probleme entstehen:
3.1.1. Sexualität
Bis zu 90 % der Männer und 80 % der Frauen mit MS leiden unter sexuellen Schwierigkeiten, was zu einer Einschränkung des Selbstwertgefühls und des Wohlbefindens führen kann. Frauen können von Symptomen wie verminderte Empfindung im Bereich der Scheide und der Klitoris, Trockenheit der Scheide, Libidoverlust oder der Schwierigkeit, einen Orgasmus zu erreichen, betroffen sein.
Bei Männern können Symptome wie Störung oder Verlust der Erektionsfähigkeit und des Ejakulationsvermögens, verringerte Empfindung im Glied sowie Libidoverlust auftreten.
Auch andere Symptome der MS wie Müdigkeit, Spastik in den Beinen oder Stuhl- und Harninkontinenz können empfindlich stören.
Wichtig ist, dass die Paare offen darüber reden. Auch können manche Störungen wirksam behandelt werden. Gegebenenfalls müssen neue Formen von Zärtlichkeit, körperlicher Nähe und Befriedigung entdeckt werden.
3.1.2. Rollenwechsel
Wegen der Unvorhersagbarkeit des Verlaufes leben die Paare in ständiger Bereitschaft Veränderungen zu akzeptieren und Pläne zu verändern. Die erkrankte Person kann Hausmann oder Hausfrau werden und die gesunde muss eventuell neben dem Beruf Aufgaben im Haushalt und in der Kinderbetreuung übernehmen. Der Alltag und der Lebensstil müssen auf die Betroffenen abgestimmt werden.
Paare, die wegen MS die Verantwortungsbereiche neu untereinander aufgeteilt haben, erachten folgende Punkte für das Zusammenleben in der Familie als wichtig:
- Alle zur Verfügung stehenden Mittel sollten eingesetzt werden, um den Alltag möglichst leicht zu gestalten (z. B. Hilfsmittel für das Haus).
- Die von der MS betroffene Person sollte sich offen mit dem Verlust ihrer Selbstständigkeit auseinandersetzen und ihn nicht verleugnen.
- Sie sollte sich ärztliche und psychosoziale Hilfe bei Fachleuten holen, um sich besser mit der Krankheit auseinandersetzen zu können.
- Der Partner oder die Partnerin darf sich selbst nicht vergessen und sollte ausreichend Aktivitäten ausserhalb der Familie wahrnehmen.
- Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familienangehörigen sollten anerkannt und der Alltag danach ausgerichtet werden.
3.1.3. Kinderwunsch
Prinzipiell bestehen für eine MS-kranke Frau keine Einwände schwanger zu werden. Es scheint sogar, dass der Verlauf der MS während der Schwangerschaft positiv beeinflusst wird. Den Partnern sollte aber klar sein, wie sie das Kind in einer schweren Krankheitsphase versorgen. Auch sollte eine Schwangerschaft nur in einer stabilen Krankheitsphase geplant werden. Bei Einnahme von Medikamenten muss mit dem Arzt oder der Ärztin abgeklärt werden, ob diese einen Einfluss auf die Schwangerschaft oder die Muttermilch haben können.
3.1.4. Schuldgefühle und falsche Schonung
Die gesunde Person hat oft Schuldgefühle, wenn sie Dinge tut, die der andern durch deren Krankheit verwehrt sind. Auch behandelt sie sie oft mit viel Rücksicht und schont sie zu sehr. Der oder die Betroffene möchte jedoch keine Sonderbehandlung und kann sich schnell unwohl und bevormundet fühlen. Auch diese Probleme lassen sich mit offenem Reden meist klären.
3.2. Die Kinder
3.2.1. Geheime Sorgen
Die meisten Kinder schildern ihren Alltag zunächst als “ganz normalen” Kinderalltag. Die MS beschreiben sie eher distanziert und unbeteiligt. Dieses harmlose Bild kommt jedoch durch ihre Anstrengungen zustande, sich den Eltern gegenüber möglichst loyal zu verhalten, die gemeinsame Last leichter zu machen und über möglichst lange Zeit hinweg ein “normales” Familienleben zu führen.
Die meisten Kinder befinden sich in einer verunsicherten Grundstimmung, einige davon leben auch in grösserer Angst und Ungewissheit. Insgeheim beobachten sie die Erkrankung des betroffenen Elternteils und stellen Überlegungen zum weiteren Verlauf oder zu möglichen Ansteckungsgefahren an.
Vor allem jüngere Kinder haben oft Angst, Vater oder Mutter könnten sterben und sie würden allein gelassen. Die Eltern sollten ihnen versichern, dass dies nicht so ist.
3.2.2. Schuldgefühle und Verantwortungsbelastung
Die Kinder kommen manchmal zu dem Schluss, dass sie an der Erkrankung der Eltern schuld sein könnten. Dieses Schuldgefühl muss stets bekämpft werden. Auch übernehmen sie in ihrem Drängen nach Unterstützung oft Verantwortung, der sie nicht gewachsen sind und die sich sehr belastend auswirkt. Es ist die Aufgabe der Eltern dies zu verhindern.
3.2.3. Loyalitätskonflikt
Die wenigsten Kinder reagieren auf die Krankheit durch Distanzierung. Eher versuchen sie den Eltern zu helfen und geraten dadurch oft in einen Loyalitätskonflikt zwischen dem “schwachen” betroffenen und dem “überforderten” nichtbetroffenen Elternteil. Sie versuchen beide Seiten zu unterstützen. In einigen Fällen teilen die Geschwister die Aufgabe, der einen oder anderen Seite Unterstützung zu geben, untereinander auf.
3.2.4. Verdrängung
Manche Kinder verdrängen die Krankheit und ihre Sorgen und Ängste. Sie bemühen sich ein möglichst “normales” Bild des Familienlebens aufrecht zu erhalten. MS ist für sie ein Tabu-Thema, auch wenn es vom Rest der Familie nicht so verstanden wird. Manche Kinder sagen auch, ihre Mutter oder ihr Vater sei gar nicht krank.
3.2.5. Unterschiede zwischen erkrankter Mutter und erkranktem Vater
Die Mütter, ob MS-betroffen oder nicht, werden von einigen Kindern als abwesend oder beschäftigt geschildert, während die Schwäche der erkrankten Väter vor allem von ihren Söhnen als kränkend erlebt wird. Väter in der Rolle des nichtbetroffenen Partners werden als hilflos oder überfordert beschrieben.
3.2.6. Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Geschwistern
Bei den ältesten oder zweitältesten Kindern wird der Wunsch nach Umsorgung und Verwöhnung deutlicher. Vor allem in Familien, in denen Unklarheiten bezüglich der Rollenverteilung und der elterlichen Verantwortung bestehen, übernehmen die älteren Geschwister manchmal die Mutter- oder Vaterrolle.
Die jüngsten Kinder leisten ihren Beitrag zur Normalisierung der Familie, indem sie Harmonie, kindliche Unwissenheit und Sorglosigkeit sowie Hilflosigkeit verkörpern. Während die älteren Kinder schnell selbstständig werden, können die Eltern bei den jüngsten Kindern ihre Elternfunktion gut wahrnehmen.
3.2.7. Schlussfolgerungen für die Eltern
Betroffene Familien erklären folgende Dinge für die Entwicklung der Kinder als wichtig:
- klare Strukturen schaffen: Unklarheit und Uneindeutigkeit sollten vermieden, Informationen nicht aus falscher Rücksichtsnahme vorenthalten werden.
- Hauptverantwortung auf der Elternebene belassen: Dem Bedürfnis der Kinder zu helfen, sollte mit klaren Aufgaben nachgekommen werden. Sie dürfen jedoch nicht mit zu viel Verantwortung belastet werden.
- Freiräume für alle schaffen: Jedes Familienmitglied sollte soziale Kontakte nach aussen pflegen, aber auch in der Familie sollten krankheitsunabhängige Erlebnisse stattfinden.
4. Meine Recherchen
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Neben den Informationen aus den Büchern und dem Internet habe ich mich als Angehörige in einem Forum für MS-Betroffene und deren Angehörige angemeldet. Dort finden Diskussionen über jeden Aspekt der Krankheit statt. Ich startete einige Umfragen und Diskussionen und kommunizierte auch über Emails mit Betroffenen, die mich alle freundlich unterstützten.
5. Zusammenfassung
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Eine Krankheit wie MS bringt Komplikationen in das Familienleben, die sich vor allem durch offenes und ehrliches Reden vereinfachen können. Sie lässt die Betroffenen aber auch selbstständiger und für Veränderungen offener werden und ein neues Verständnis für viele Dinge entwickeln.
Persönliches Schlusswort
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ich bin als Enkelin nicht in gleicher Weise und Stärke betroffen, erlebe aber trotzdem einige Aspekte der Krankheit. Das intensive Befassen mit dem Thema und der Austausch mit anderen Angehörigen hat mir und meinem in letzter Zeit auftretenden Bedürfnis nach Auseinandersetzung auf jeden Fall gut getan.
Literaturverzeichnis
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bücher:
- Bischof, K. & Beer, S. (1999). Auch kleine Schritte führen weiter, Multiple Sklerose – die unfassbare Krankheit (1. Aufl.). Zürich: Haffmans Sachbuch.
- Dr. med. Krämer, G. & Prof. Dr. med. Besser, R. (1997). Multiple Sklerose: Antworten auf die häufigsten Fragen: Hilfreiche Erstinformationen für Betroffene und Interessierte (3. Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Papst, J., Dinkel-Sieber, S., Knobel, J. & Rauber, J. (1998). Forschungsprojekt “Kinder in Familien mit einem chronisch kranken Elternteil am Beispiel der Multiplen Sklerose”, Ergebnisse (1. Aufl.). Zürich: SMSG.
Internet:
- Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. (1990). Gefunden am 1. Februar 2003 unter www.dmsg.de
- HaMSter - Deutsche Multiple Sklerose Selbsthilfe e.V. (2002). Gefunden am 11. Februar 2003 unter www.hdmss.de
- Informationen über Multiple Sklerose, eine private Initiative zum Thema MS. (2000). Gefunden am 7. Februar 2003 unter www.muskl.de
- Leben mit MS. (2002). Gefunden am 11. Februar 2003 unter www.leben-mit-ms.de
- MS life. (2002). Gefunden am 15. April 2003 unter www.ms-life.de
- Multiple Sklerose Chat. (1998). Gefunden am 7. Februar 2003 unter www.multiplesklerosechat.de
- Multiple Sklerose Webring. (2001). Gefunden am 7. Februar 2003 unter www.ms-webring.de
- multiple sklerosis international federation: World of Multiple Sklerosis. (1996). Gefunden am 9. März 2003 unter www.msif.org/de/
- Schweizer Multiple Sklerose Gesellschaft. (nicht eruierbar). Gefunden am 1. Februar 2003 unter www.multiplesklerose.ch
Vielen Dank fürs lesen und für Kommentare. Fragen beantworte ich gerne!
Siana
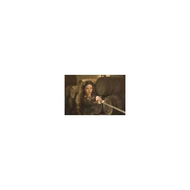

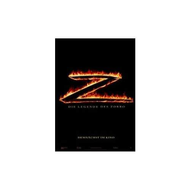
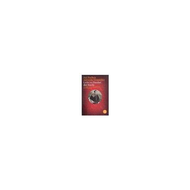
Bewerten / Kommentar schreiben