Erfahrungsbericht von Indigo
Die Hochwasserkatastrophe und warum Spender Spenden spenden!
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Nein
Die Hochwasserkatastrophe und warum Spender Spenden spenden!
Anlässlich der Hochwasserhilfsaktionen und der damit verbundenen Spendenaufrufe habe ich diesen Beitrag aktualisiert. Es geht hier in erster Linie nicht um einen Appell zu spenden, sondern darum, die Motivation zum Spenden etwas transparenter zu gestalten.
Die Grundaussagen beziehen sich auf die Motivation zu spenden, ohne dass eine Katastrophe mit politischer und medialer Unterstützung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wird.
Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind aktuell so wohlhabend und reich wie nie zuvor. Das angelegte Geldvermögen bei Banken und Versicherungen beträgt etwa 1,8 Billionen Euro. Dabei sind Aktien, Immobilien und sonstige Anlageformen nicht mitgerechnet. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur deswegen eines der reichsten Länder der Welt.
Die Kapitalerträge des privaten Vermögens werden jährlich neu angelegt, sollen die Lebensqualität erhöhen oder sie dienen der Altersvorsorge. Seit 1945 wurde die Wochenarbeitszeit kontinuierlich gesenkt und die Freizeit hat zugenommen. – Freizeit kostet Geld. Gleichzeitig wächst die Zahl kinderloser Paare und die Zahl der Einpersonenhaushalte. Trotzdem werden nach statistischen Angaben in den nächsten 10 Jahren ca. eine Billionen Euro vererbt. Ich kann diese Zahl nicht ausschreiben, weil ich mir hinsichtlich der Antahl der Nullen nicht sicher bin.
Spender für gemeinnützige Zwecke handeln aus unterschiedlichen Motiven. In der Regel ist nicht Selbstlosigkeit das Motiv, sondern eine durchaus nachvollziehbare Gegenerwartung. Gegenwärtig geht es um die Identität Deutschlands und um Hilfsbereitschaft an sich. Viele Menschen spenden, um ganz einfach zu helfen. Einige lehnen Geldspenden grundsätzlich ab, da sie nicht glauben, dass die Spenden, da ankommen, wo sie sollen. Andere kritisieren Sachspenden, weil im Moment noch gar nicht klar ist, was tatsächlich gebraucht wird.
Im alten Rom war es Gaius C. Maecenas, der z.B. talentierte Nachwuchsliteraten wie Horaz oder Vergil förderte und damit seinen Namen als Mäzen verewigt hat. Nach ihm ist auch das sogenannte Mäzenatentum benannt. Weiterhin kann ein Lotteriegewinn (Aktion Mensch), ein Steuervorteil oder die kostenlose Entsorgung von Altmaterial ein Motiv zur Spende sein. Wir kennen darüber hinaus Prominente, die ein durchaus selbstkritisches Verhältnis zu ihrem Vermögen haben und vor diesem Hintergrund ihres Erachtens soziale Projekte unterstützen und finanzieren, z.B. Herbert Grönemeyer. Andere Künstler suchen die Publicity und lassen über ihr Management den Werbeeffekt errechnen.
Im immateriellen Sinne ist das Motiv zumeist mit der Erlangung eines guten Gewissens verknüpft. So gelingt es insbesondere den Kirchen, und dies besonders in der Weihnachtszeit, enorme Spendensummen in ihrer Gemeinde zu sammeln. „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.“ Ist ein dazu passender Ablassspruch aus dem 16. Jahrhundert. Nach Thomas von Aquin „geht eher ein Reicher durch ein Nadelöhr als dass er in den Himmel kommt“ und selig sind die Armen, denn ihnen ist das Himmelreich. – Ein auch heute noch nachvollziehbares Motiv für Spender, wenn sie denn Geld haben.
Ebenso wie Angstgefühle spricht der Anblick hungernder Kinder in der sogenannten dritten Welt oder jetzt die Berichterstattung zu den Hochwasseropfern das Gewissen an. Natürlich geht es auch um gesellschaftliches Ansehen und Imagegewinn. Schon Gaius C. Maecenas erhielt einen erheblichen Prestigegewinn. Voraussetzung dabei ist allerdings, dass der Akt der Spende öffentlich wird, was wiederum auch nicht allen Spendern Recht ist.
Ein weiteres Spendenmotiv ist in persönlichen Vorlieben zu sehen. Der reiche Unternehmer, der selbst ein leukemiekrankes Kind hat, spendet für die Leukemiestiftung, oder der Rentier unterstützt ein bestimmtes universitäres Forschungsvorhaben, welches ihn sein Leben lang interessiert hat. Gegenwärtig sammeln Kindergärten für betroffene Kindergärten und der Verband der Wohnungsbaugesellschaften ruft seine Mitglieder dazu auf, betrofffene Wohnungsunternehmen zu unterstützen.
Nur die Spendenverlässlichkeit hat nachgelassen. Gespendet wird in der Währung Euro. Da es jedoch stets einen Menschen gibt, der mehr hat als ich, kann leicht gesagt werden: Dann soll der doch spenden und nicht ich.
Dennoch werden aktuell Millionenbeträge gesammelt. Die Medien fordern zum Spenden auf, die Kulturschaffenden organisieren Benefizveranstaltungen und Die Fußballbundesliga organisiert Spiele für den guten Zweck. Momentan hilft ganz Europa, sogar die ersten Hilfstransporte aus Russland sind in Sachsen und in der Prignitz angekommen.
Das Motiv ist mit der nachvollziehbaren Katastrophe ebenso zu begründen wie mit der vorhandenen Solidarität.
Viele kritische Positionen sagen, dass man gegenwärtig zunächst abwarten sollte, da der tatsächliche Bedarf in den betroffenen Hochwassergebieten noch gar nicht feststeht. Die Oderflut vor fünf Jahren im Land Brandenburg hat deutlich gezeigt, dass die zusammengetragenen Spenden teilweise gar nicht und teilweise auf sehr bedenkliche Weise verteilt wurden. Andererseits wird die aktuelle Spendenbereitschaft für die Hochwasseropfer mit zunehmender Zeit abnehmen.
Jeder mache, was er für richtig hält!
Vielleicht kann dieser Beitrag ein wenig zur kritischen Meinungsbildung beitragen
Indigo
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2005-01-26 15:19:37 mit dem Titel Der Crash-Kurs für Yopi-User zur Schreibblockade und dem Desaster des Denkens
Der Crashkurs für Yopi-User zur Schreibblockade und dem Desaster des Denkens
Zum dritten Mal erhebe ich mich, werfe einen kritischen Blick auf den Monitor und wende mich verächtlich von der Tastatur ab. Vielleicht sollte ich das Geschirr abwaschen, Blumen gießen oder wieder frischen Kaffee kochen. Ob ich vielleicht Post habe? Ich könnte ja kurz runter gehen und nachschauen. Eine dieser zahlreichen Ideen werde ich ergreifen und danach wieder vor dem Monitor sitzen. Der Cursor blinkt, das Blatt auf weißem Hintergrund immer noch leer. Ist Blumengießen zweimal am Tag genug oder zuviel?
Schreibblockade, Denkdesaster, nichts geht mehr ....
Kennen wir diese Situation nicht alle in irgendeiner Form aus der Schule, dem Studium oder dem Beruf oder gar aus dem Privatleben, wenn wir Briefe schreiben wollen? Manchmal verqueren sich die Gedanken und wollen einfach nicht vom Kopf über die Hand in den Computer fließen. Ich kann nicht schreiben, das klingt alles bescheuert, ich bin völlig untalentiert, das leere Blatt kotzt mich an, ich habe einfach nichts zu sagen und ich kann mich nicht konzentrieren. Wie soll ich bloß anfangen und was will ich eigentlich schreiben.
Ich kenne Menschen, die nachts um zwei Uhr beim Berliner Krisentelefon anrufen und die Schreibblockaden ihrer Abschlussarbeit thematisieren.
Was kann man da tun?
Zunächst geht es wohl darum die Manifestierung der vorgenannten Vorurteile zu verhindern. Sicher ist, dass die meisten Menschen dieses Problem kennen und ebenso sicher ist, dass alle schreiben können. Es sollte darum gehen, die Potentiale der eigenen Phantasie kennen zu lernen, die Beschränkungen des schulischen Deutschunterrichts aus der Vergangenheit durch die Formulierungsfreiheit abzulösen und womöglich mit Schreibübungen zu beginnen, die Spaß und Freude bereiten. Hier ist Yopi ein sehr hilfreiches Modell. Schreiben lernen Menschen durch Schreiben. Lesen lernen wir durch Lesen.
Wissenschaftler empfehlen diesbezüglich zunächst über die Schwierigkeiten des Schreibens zu schreiben. Ein Terminkalender enthält Notizen, welche man in Sätze fassen kann. Eine Idee, die aus zwei Sätzen besteht, könnte man zunächst aufs Papier bringen. Man kann als erster von sich selbst schreiben, die eigene Sprache entdecken, indem man ein Kindheitserlebnis, eine Begegnung oder einen Lebenslauf formuliert. Da liegen feste Bezüge vor, das Geburtsdatum, der Ort die Einschulung etc.
Am Anfang kann man ungestört die eigene Alltagssprache benutzen, man muss zunächst nicht berücksichtigen, das Geschriebenes gelesen wird. Schreibt man z.B. bei Yopi über ein Produkt, ist es sehr hilfreich zunächst völlig unabhängig von der Präsentation Fragen zu formulieren, die man selbst zu dem Produkt hätte.
Eine weitere gute Schreibübung ist das Lesen. Wer viel ließt, lernt viel Sprache und erweitert seine Selektionsmöglichkeiten. So wäre vielen neuen Mitgliedern bei Yopi vor ihrem ersten Beitrag zu empfehlen, Beiträge zu lesen. Es entsteht ein Gefühl für das Spektrum, für Unterschiede und für Beitragsstrukturen.
Ein weiterer Tipp: Schnelles schreiben reduziert die Blockaden. Korrekturen kann man später immer noch vornehmen. Erst einmal alles in den Computer hinein, dann speichern und später erst sortieren, abwägen oder korrigieren. Es ist völlig unnötig, nach jedem Satz über den Satz nachzudenken. Der Satz wirkt später im Gesamttext ganz anders als frisch formuliert.
Abschließend sollen noch drei Hilfstechniken kurz vorgestellt werden, die den Einstieg ins Schreiben erleichtern können.
a) Freewriting
Freewriting ist ein gutes Einstiegskonzept und ganz einfach: Man schreibt fünf Minuten ohne Denkpause einfach drauf los. Fällt einem nichts ein, dann schreibt er über den Kugelschreiber, das Blatt Papier oder seine Hand. Aber man schreibt, egal was. Freewriting hilft die Motivation zum Schreiben zu starten, es ordnet Gedanken, wenn das Gehirn Error anzeigt. Freewriting führt keineswegs zu tollen und gehaltvollen Texten, aber die Schreibkraft wird unterstützt.
b) Clustern
Das Clustern geht davon aus, dass zu einem Thema ein Kernwort formuliert wird und direkt in der Mitte eines Blattes Papier platziert wird. Alle nun folgenden Einfälle und Ideen werden kreisförmig um diesen Kernbegriff auf das Blatt Papier geschrieben. Nun wartet man auf den ersten Satz, der einem dazu einfällt und schreibt diesen sofort auf. Danach werden alle Einzelbegriffe in Satzform gebracht, so dass ein text entsteht.
c) Brainstorming/Brainwriting
Wenn ein Grobthema feststeht, wird nach diesem Vorschlag eine spontane Liste erstellt, die alle Ideen zu dem Thema enthält. Die Liste soll in nicht mehr als maximal zehn Minuten entstehen. Gefällt einem die so entstandene Liste nicht, bleibt sie dennoch unverändert und man macht eine völlig Neue. Beim Durchgehen der so entstandenen Liste werden Zusammenhänge per Textmarker farbig markiert und Besonderheiten mit Ausrufungszeichen versehen. Entstehen dabei neue Aspekte zu dem Thema, so werden diese unten an die Liste gehängt. So entsteht eine erste grobe Struktur, die im nächsten schritt in Sätze gefasst wird.
Anmerkung:
In Berlin gibt es ein sogenanntes Schreiblabor, welches in einem hochschuldidaktischen Zentrum Schreibblockaden von Studierenden sehr hilfreich bearbeitet.
Tipp: hdz@asfh-berlin.de
Anlässlich der Hochwasserhilfsaktionen und der damit verbundenen Spendenaufrufe habe ich diesen Beitrag aktualisiert. Es geht hier in erster Linie nicht um einen Appell zu spenden, sondern darum, die Motivation zum Spenden etwas transparenter zu gestalten.
Die Grundaussagen beziehen sich auf die Motivation zu spenden, ohne dass eine Katastrophe mit politischer und medialer Unterstützung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wird.
Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind aktuell so wohlhabend und reich wie nie zuvor. Das angelegte Geldvermögen bei Banken und Versicherungen beträgt etwa 1,8 Billionen Euro. Dabei sind Aktien, Immobilien und sonstige Anlageformen nicht mitgerechnet. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur deswegen eines der reichsten Länder der Welt.
Die Kapitalerträge des privaten Vermögens werden jährlich neu angelegt, sollen die Lebensqualität erhöhen oder sie dienen der Altersvorsorge. Seit 1945 wurde die Wochenarbeitszeit kontinuierlich gesenkt und die Freizeit hat zugenommen. – Freizeit kostet Geld. Gleichzeitig wächst die Zahl kinderloser Paare und die Zahl der Einpersonenhaushalte. Trotzdem werden nach statistischen Angaben in den nächsten 10 Jahren ca. eine Billionen Euro vererbt. Ich kann diese Zahl nicht ausschreiben, weil ich mir hinsichtlich der Antahl der Nullen nicht sicher bin.
Spender für gemeinnützige Zwecke handeln aus unterschiedlichen Motiven. In der Regel ist nicht Selbstlosigkeit das Motiv, sondern eine durchaus nachvollziehbare Gegenerwartung. Gegenwärtig geht es um die Identität Deutschlands und um Hilfsbereitschaft an sich. Viele Menschen spenden, um ganz einfach zu helfen. Einige lehnen Geldspenden grundsätzlich ab, da sie nicht glauben, dass die Spenden, da ankommen, wo sie sollen. Andere kritisieren Sachspenden, weil im Moment noch gar nicht klar ist, was tatsächlich gebraucht wird.
Im alten Rom war es Gaius C. Maecenas, der z.B. talentierte Nachwuchsliteraten wie Horaz oder Vergil förderte und damit seinen Namen als Mäzen verewigt hat. Nach ihm ist auch das sogenannte Mäzenatentum benannt. Weiterhin kann ein Lotteriegewinn (Aktion Mensch), ein Steuervorteil oder die kostenlose Entsorgung von Altmaterial ein Motiv zur Spende sein. Wir kennen darüber hinaus Prominente, die ein durchaus selbstkritisches Verhältnis zu ihrem Vermögen haben und vor diesem Hintergrund ihres Erachtens soziale Projekte unterstützen und finanzieren, z.B. Herbert Grönemeyer. Andere Künstler suchen die Publicity und lassen über ihr Management den Werbeeffekt errechnen.
Im immateriellen Sinne ist das Motiv zumeist mit der Erlangung eines guten Gewissens verknüpft. So gelingt es insbesondere den Kirchen, und dies besonders in der Weihnachtszeit, enorme Spendensummen in ihrer Gemeinde zu sammeln. „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.“ Ist ein dazu passender Ablassspruch aus dem 16. Jahrhundert. Nach Thomas von Aquin „geht eher ein Reicher durch ein Nadelöhr als dass er in den Himmel kommt“ und selig sind die Armen, denn ihnen ist das Himmelreich. – Ein auch heute noch nachvollziehbares Motiv für Spender, wenn sie denn Geld haben.
Ebenso wie Angstgefühle spricht der Anblick hungernder Kinder in der sogenannten dritten Welt oder jetzt die Berichterstattung zu den Hochwasseropfern das Gewissen an. Natürlich geht es auch um gesellschaftliches Ansehen und Imagegewinn. Schon Gaius C. Maecenas erhielt einen erheblichen Prestigegewinn. Voraussetzung dabei ist allerdings, dass der Akt der Spende öffentlich wird, was wiederum auch nicht allen Spendern Recht ist.
Ein weiteres Spendenmotiv ist in persönlichen Vorlieben zu sehen. Der reiche Unternehmer, der selbst ein leukemiekrankes Kind hat, spendet für die Leukemiestiftung, oder der Rentier unterstützt ein bestimmtes universitäres Forschungsvorhaben, welches ihn sein Leben lang interessiert hat. Gegenwärtig sammeln Kindergärten für betroffene Kindergärten und der Verband der Wohnungsbaugesellschaften ruft seine Mitglieder dazu auf, betrofffene Wohnungsunternehmen zu unterstützen.
Nur die Spendenverlässlichkeit hat nachgelassen. Gespendet wird in der Währung Euro. Da es jedoch stets einen Menschen gibt, der mehr hat als ich, kann leicht gesagt werden: Dann soll der doch spenden und nicht ich.
Dennoch werden aktuell Millionenbeträge gesammelt. Die Medien fordern zum Spenden auf, die Kulturschaffenden organisieren Benefizveranstaltungen und Die Fußballbundesliga organisiert Spiele für den guten Zweck. Momentan hilft ganz Europa, sogar die ersten Hilfstransporte aus Russland sind in Sachsen und in der Prignitz angekommen.
Das Motiv ist mit der nachvollziehbaren Katastrophe ebenso zu begründen wie mit der vorhandenen Solidarität.
Viele kritische Positionen sagen, dass man gegenwärtig zunächst abwarten sollte, da der tatsächliche Bedarf in den betroffenen Hochwassergebieten noch gar nicht feststeht. Die Oderflut vor fünf Jahren im Land Brandenburg hat deutlich gezeigt, dass die zusammengetragenen Spenden teilweise gar nicht und teilweise auf sehr bedenkliche Weise verteilt wurden. Andererseits wird die aktuelle Spendenbereitschaft für die Hochwasseropfer mit zunehmender Zeit abnehmen.
Jeder mache, was er für richtig hält!
Vielleicht kann dieser Beitrag ein wenig zur kritischen Meinungsbildung beitragen
Indigo
----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2005-01-26 15:19:37 mit dem Titel Der Crash-Kurs für Yopi-User zur Schreibblockade und dem Desaster des Denkens
Der Crashkurs für Yopi-User zur Schreibblockade und dem Desaster des Denkens
Zum dritten Mal erhebe ich mich, werfe einen kritischen Blick auf den Monitor und wende mich verächtlich von der Tastatur ab. Vielleicht sollte ich das Geschirr abwaschen, Blumen gießen oder wieder frischen Kaffee kochen. Ob ich vielleicht Post habe? Ich könnte ja kurz runter gehen und nachschauen. Eine dieser zahlreichen Ideen werde ich ergreifen und danach wieder vor dem Monitor sitzen. Der Cursor blinkt, das Blatt auf weißem Hintergrund immer noch leer. Ist Blumengießen zweimal am Tag genug oder zuviel?
Schreibblockade, Denkdesaster, nichts geht mehr ....
Kennen wir diese Situation nicht alle in irgendeiner Form aus der Schule, dem Studium oder dem Beruf oder gar aus dem Privatleben, wenn wir Briefe schreiben wollen? Manchmal verqueren sich die Gedanken und wollen einfach nicht vom Kopf über die Hand in den Computer fließen. Ich kann nicht schreiben, das klingt alles bescheuert, ich bin völlig untalentiert, das leere Blatt kotzt mich an, ich habe einfach nichts zu sagen und ich kann mich nicht konzentrieren. Wie soll ich bloß anfangen und was will ich eigentlich schreiben.
Ich kenne Menschen, die nachts um zwei Uhr beim Berliner Krisentelefon anrufen und die Schreibblockaden ihrer Abschlussarbeit thematisieren.
Was kann man da tun?
Zunächst geht es wohl darum die Manifestierung der vorgenannten Vorurteile zu verhindern. Sicher ist, dass die meisten Menschen dieses Problem kennen und ebenso sicher ist, dass alle schreiben können. Es sollte darum gehen, die Potentiale der eigenen Phantasie kennen zu lernen, die Beschränkungen des schulischen Deutschunterrichts aus der Vergangenheit durch die Formulierungsfreiheit abzulösen und womöglich mit Schreibübungen zu beginnen, die Spaß und Freude bereiten. Hier ist Yopi ein sehr hilfreiches Modell. Schreiben lernen Menschen durch Schreiben. Lesen lernen wir durch Lesen.
Wissenschaftler empfehlen diesbezüglich zunächst über die Schwierigkeiten des Schreibens zu schreiben. Ein Terminkalender enthält Notizen, welche man in Sätze fassen kann. Eine Idee, die aus zwei Sätzen besteht, könnte man zunächst aufs Papier bringen. Man kann als erster von sich selbst schreiben, die eigene Sprache entdecken, indem man ein Kindheitserlebnis, eine Begegnung oder einen Lebenslauf formuliert. Da liegen feste Bezüge vor, das Geburtsdatum, der Ort die Einschulung etc.
Am Anfang kann man ungestört die eigene Alltagssprache benutzen, man muss zunächst nicht berücksichtigen, das Geschriebenes gelesen wird. Schreibt man z.B. bei Yopi über ein Produkt, ist es sehr hilfreich zunächst völlig unabhängig von der Präsentation Fragen zu formulieren, die man selbst zu dem Produkt hätte.
Eine weitere gute Schreibübung ist das Lesen. Wer viel ließt, lernt viel Sprache und erweitert seine Selektionsmöglichkeiten. So wäre vielen neuen Mitgliedern bei Yopi vor ihrem ersten Beitrag zu empfehlen, Beiträge zu lesen. Es entsteht ein Gefühl für das Spektrum, für Unterschiede und für Beitragsstrukturen.
Ein weiterer Tipp: Schnelles schreiben reduziert die Blockaden. Korrekturen kann man später immer noch vornehmen. Erst einmal alles in den Computer hinein, dann speichern und später erst sortieren, abwägen oder korrigieren. Es ist völlig unnötig, nach jedem Satz über den Satz nachzudenken. Der Satz wirkt später im Gesamttext ganz anders als frisch formuliert.
Abschließend sollen noch drei Hilfstechniken kurz vorgestellt werden, die den Einstieg ins Schreiben erleichtern können.
a) Freewriting
Freewriting ist ein gutes Einstiegskonzept und ganz einfach: Man schreibt fünf Minuten ohne Denkpause einfach drauf los. Fällt einem nichts ein, dann schreibt er über den Kugelschreiber, das Blatt Papier oder seine Hand. Aber man schreibt, egal was. Freewriting hilft die Motivation zum Schreiben zu starten, es ordnet Gedanken, wenn das Gehirn Error anzeigt. Freewriting führt keineswegs zu tollen und gehaltvollen Texten, aber die Schreibkraft wird unterstützt.
b) Clustern
Das Clustern geht davon aus, dass zu einem Thema ein Kernwort formuliert wird und direkt in der Mitte eines Blattes Papier platziert wird. Alle nun folgenden Einfälle und Ideen werden kreisförmig um diesen Kernbegriff auf das Blatt Papier geschrieben. Nun wartet man auf den ersten Satz, der einem dazu einfällt und schreibt diesen sofort auf. Danach werden alle Einzelbegriffe in Satzform gebracht, so dass ein text entsteht.
c) Brainstorming/Brainwriting
Wenn ein Grobthema feststeht, wird nach diesem Vorschlag eine spontane Liste erstellt, die alle Ideen zu dem Thema enthält. Die Liste soll in nicht mehr als maximal zehn Minuten entstehen. Gefällt einem die so entstandene Liste nicht, bleibt sie dennoch unverändert und man macht eine völlig Neue. Beim Durchgehen der so entstandenen Liste werden Zusammenhänge per Textmarker farbig markiert und Besonderheiten mit Ausrufungszeichen versehen. Entstehen dabei neue Aspekte zu dem Thema, so werden diese unten an die Liste gehängt. So entsteht eine erste grobe Struktur, die im nächsten schritt in Sätze gefasst wird.
Anmerkung:
In Berlin gibt es ein sogenanntes Schreiblabor, welches in einem hochschuldidaktischen Zentrum Schreibblockaden von Studierenden sehr hilfreich bearbeitet.
Tipp: hdz@asfh-berlin.de
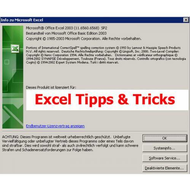
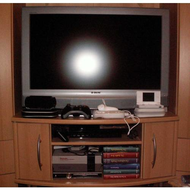



Bewerten / Kommentar schreiben