Erfahrungsbericht von Zwergi333
Bereit für die Wahrheit?
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
Einleitung
Es ist schon ein Weilchen her, dass ich mir diesen Film anbgeschaut habe. Aber ich hab ihn noch total gut im Gedächnis, so dass ich ihn hier vorstellen möchte ;)
Inhalt
Unmittelbar vor Philadelphia kommt es zu einem Zugunglück, das 131 Tote fordert. Nur ein Mann überlebt, ohne eine Schramme. Es ist David Dunn (Bruce Willis), Sicherheitsbeamter im städtischen Stadion. Zurück in seiner unglücklichen Existenz - die Ehe mit Audrey (Robin Wright) droht zu zerbrechen, die Beziehung zum gemeinsamen Sohn (Spencer Treat Clark) leidet nicht minder an seiner fast autistischen Traurigkeit - nimmt der von einer seltenen Knochenkrankheit Comic-Spezialist geplagte Elijah Price (Samuel L. Jackson) Kontakt mit ihm auf. Der glaubt in Dunn das Gegenstück zu seinem morschen Körper gefunden zu haben: Einen unzerbrechlichen Superhelden. David tut dessen Drängen zunächst als Spinnerei ab, doch die nagenden Fragen seines Gegenübers bringen ihn zum Nachdenken. Zuerst stellt David fest, dass er noch keinen Tag seines Diensts krank gemeldet war, dann scheint er beim Hanteltraining übermenschliche Kräfte zu besitzen. David forscht in der Vergangenheit, um die Gegenwart zu reparieren: War er wirklich nie verletzt? Ist er tatsächlich ein Superheld oder fällt er den Illusionen des charismatischen Comicnarren zum Opfer? Zugleich muss er auch im Privaten die Existenz neu bedenken: Seine Frau will die zerrüttete Ehe kitten, sein Sohn träumt vom geliebten Vater als Supermann. Schließlich stellt sich David seinen Ängsten...
Kritik
\"Ich habe so etwas noch nie gesehen.\" Erst, wo die Realität kippt, das Unfassbare die Banalität des Alltags überwältigt, kann das Kino von M. Night Shyamalan ansetzen. Ein Mann sitzt im Zug, auf der Heimreise von einem Vorstellungsgespräch. Eine zum Flirt tendierende Unterhaltung zerbröselt, dann sieht man ihn in Nahaufnahme: Er trägt das Gesicht von Bruce Willis, dem Verletzlichen unter den amerikanischen Actionstars.
Das Rattern des Zuges drängt sich nach vor, das Geräusch beschleunigt sich, der Held wendet den Kopf und sieht uns an: Etwas Schreckliches steht unmittelbar bevor.
Ein katastrophaler Zugunfall, der 131 Menschen das Leben kostet und nur den Helden, David Dunn, wie durch ein Wunder unverletzt zurücklässt, löst die Handlung von Unbreakable aus, doch nur die Folgen des Unglücks sind zu sehen. Unzerbrechlich heißt der Film, aber zerbrechlich, fragil wäre gerne seine Konstruktion, so wie das Innere seiner zweiten Hauptfigur, des Comic-Spezialisten Elijah Price (Samuel L. Jackson). Der leidet an einer seltenen Knochenkrankheit: Ein Sturz, ein heftiger Schlag und das Innere seines Körper wird aufs Neue zertrümmert - eine Rückblende entführt uns in seine einsame, ängstliche Jugend und eine Reflektion auf einem Fernsehschirm, die das Gespräch zeigt, in dem ihm seine Mutter (die wirklich nuancierte Darstellung des Films: Charlayne Woodward) zum Trost das erste Comic anbieten wird. Die Welt der bunten Hefte, das hat uns schon zu Anfang ein Zwischentitel angekündigt, ist eine mächtige, einflussreiche. Elijah verfällt ihr, analysiert sie, baut sie neu: \"Eine klassische Darstellung des Kampfes von Gut und Böse\", erläutert er eine Zeichnung im seltsam leblosen Bewunderungsareal seiner Comic-Kunstgalerie mit dem passenden Namen Limited Edition: Schatten und Licht, Schwarz und Weiß - da in der Welt der Superheldencomics alles seine Entsprechung findet, vermeint er in David Dunn auch endlich sein positives Spiegelbild gefunden zu haben: Das Gegenteil seines spröden Knochenbaus, der unverletzte Überlebende, unzerbrechlich eben.
David glaubt noch nicht an seine Bestimmung: Den Überzeugungsversuchen Elijahs, dem Jackson, abseits seiner festgefahrenen Rollenschiene mit einem ganzen Arsenal stilisierten Zubehörs (klackender Stock, Stachelbeinprothese, stechender Blick unter schiefer Frisur, die selbstgefällige, ruhelose Diktion eines Zynikers) tatsächlich etwas genuin Obsessives zu verleihen mag, ist der Großteil des Films gewidmet. Security Man: Ein ominöser Schattenriss im Stadion, umweht von seiner Arbeitsuniform. Was für den Zuschauer von Anfang an zu sehen ist, muss Dunn erst realisieren. Und so widmet sich Unbreakable im Detail der Rekonstruktion einer nicht erinnerten Vergangenheit: Keine Krankheit in fünf Dienstjahren, keine Verletzung, die der genauen Rückschau standhalten würde.
Der Film auch nicht: Unbreakable markiert für den Regisseur einen deutlichen Fortschritt gegenüber seinem Vorgängerfilm Der Sechste Sinn. Im Visuellen strebt Shyamalan eine Annäherung an die Comic-Welten an, die seine Erzählung unterfüttern: Blockierte Einstellungen wie aus den Panels der Hefte, wobei Objekte im Vordergrund Figuren verbergen; Rahmen im Bildrahmen, bevorzugt als Einstellung auf spiegelnde Oberflächen, das leere Bewusstsein eines endlosen Referenzsystems. Viele Zutaten sind dieselben wie letztes Jahr - ein feuchtes, dröges Philadelphia, hinter dessen trostlosen Fassaden ein fast autistischer Held den Frieden mit seiner Bestimmung finden muss, eine zerborstene Kleinfamilie, vom Kommunikationszusammenbruch getrennt. Shyamalans Filme sind Heilsgeschichten, die den Nukleus des Kleinbürgertums wieder kitten: Robin Wright Penn als Dunns Ehefrau, die hinter einem überdimensionalen Cocktailglas einen Neubeginn der auseinander gelebten Beziehung anstrebt, und Spencer Treat Clark als Sohn, dem der Wunschtraum vom Vater als Superhelden eine zweite Chance auf eine funktionierende Kindheit ermöglicht, bleiben dennoch nur Anhängsel, Füllmaterial, das das Erfolgsrezept des Vorgängers neu gruppiert, verfeinert, aber nicht erweitert. Weniger New-Age-befrachtet als in Der Sechste Sinn versteifen sich Shyamalans visuelle Metaphern einmal mehr auf die Feier des heilenden Verständnisses unter der Entfremdung in der modernen Welt (deren Ursachen unbegründet, bloße Symptome bleiben). Auch wenn die Handlung immer ambivalent sein soll, wird am Schluss alles in eine niedliche Spielberg-Welt zusammengeführt, in der die emotionale Auflösung die Beschäftigung mit den Problemen ersetzt.
Unzerbrechlich baut den Superheldenmythos als Kunstfilm neu - das behäbige Tempo, die fein texturierten Bilder, die betont symmetrisch gebauten Handlungsfäden verdecken nicht, dass hier alte Säcke als des Kaisers neue Kleider verkauft werden. (Auch die bewussten Doppelungen rauben dem Familiensubplot die Kraft, abgesehen von seiner Wiedererkennbarkeit: Als das Gegenstück zur wesentlich weniger breitgetretenen Beziehung von Elijah zu seiner Mutter wirkt er nur noch prätentiös wie vieles hier.)
Dabei passt die Comicwelt eigentlich viel besser zu Shyamalans Verklärung banaler Inhalte, auch wenn sich gelegentlich der unangenehme Verdacht aufdrängt, dass im neuen Film auch noch der andere Totengräber des populären Kinos, George Lucas, integriert wird: Hier wird jetzt die Privatmythologie zur restaurativen Glückseligkeit gezimmert. Die, ist, nicht zuletzt dank Jackson nicht ohne Reiz. (Willis hingegen ist ganz wie im Sechsten Sinn leider durch die Anforderungen der Rolle auf ein schwermütiges Starren beschränkt - vom großen körperlichen Schauspieler, der ohne viel Worte in Twelve Monkeys eine geradezu existenzielle Darstellung erreichte, ist wieder nichts zu spüren.) Jackson und der Regisseur tragen hier wirklich eine persönliche Besessenheit in die Welt: Die Monologe des Schauspielers zeigen Leidenschaft für das Thema, Shyamalan setzt nicht nur im Bildaufbau (man wartet darauf, dass die im schläfrigen Tempo hervorgewisperten Sätze wie Sprechblasen über den Figuren erscheinen), sondern auch in der Story und weiteren Gestaltungsmitteln (Zwischentitel als Prolog und Epilog) auf Verwandtschaft zum gern belächelten Genre (und erweist ihm im Aufbürden der Gewichtigkeit einen Bärendienst). Nicht zufällig spielt die beste Szene von Unzerbrechlich in einem Comic-Shop. Wortlos starrend sitzt Elijah in seinem Rollstuhl im hintersten Gang, eine enttäuschende Pixies-Coverversion nervt aus dem Radio, ein sichtlich unsicherer Angestellter will den schweigsamen Gast vor Ladenschluss hinausbugsieren. Ein rollender Kampf einen Gang hinunter, auf den Zuschauer zu: Elijah verdreht immer wieder die Räder seines Stuhls, kracht sprachlos gegen Regale, wirft die Ständer um. Vor der Hingabe dieses Mannes entsteht ein kaltes Unbehagen, das der Rest des Films nie wieder einfängt. Blöderweise endet die Szene dann doch wieder in einem Hinweis - wie schon zuletzt baut Shyamalan seinen Film auf einen Überraschungseffekt hin, scheinbar um kommerziellen Erwägungen gerecht zu werden, und diesmal beißt er sich wirklich in den Schwanz: Einen dümmeren Schluss hat man das ganze Jahr nicht gesehen.
Verraten wird er natürlich nicht (soll sich jeder selber ärgern) und eigentlich ist er logisch zwingend: Eine der Qualitäten von Unzerbrechlich ist nämlich ein stark ausgeprägter Sinn fürs Lächerliche, das kaltschnäuzig dramatisch präsentiert wird. Der Symbolik Shyamalans haftet diesmal die simple Schwarzweißmalerei der meisten frühen Comic-Universen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wenn Elijah stürzt, und sein Stock in tausend Stücke bricht, um den Vorgang im Innern seines Körpers zu versinnbildlichen, hat die banale Entsprechung fast schon wieder komische Qualität - es ist auf jeden Fall wesentlich weniger ärgerlich als die überangestrengte Aufdringlichkeit, mit der im Sechsten Sinn - oh, Symbol entschwundener Jugend - ein roter Ballon fast ebenso lang zur Decke hinaufsteigen schien, wie das Kindheitstrauma, das er repräsentieren sollte, dauerte. Mit der Zeit reizt Shyamalan die neugefundene Möglichkeit bis zum Anschlag aus: Eine Familienszene am Küchentisch, die vom Gefährlichen ins Lachhafte kippt, enigmatische Stehsätze, die im Kontext nur mehr befremden: \"Wasser ist dein Kryptonit\", \"Aber die Liebe währt ewiglich\" usw.
Selbst die Story macht keinen Hehl daraus, dass sie an den Haaren herbeigezogen ist: Realisiert man es tatsächlich nicht, dass man sein Leben lang nie krank oder verletzt war? Unwahrscheinlich - wie vieles in Unzerbrechlich gibt sich der Auslöser als reine Konstruktion zu erkennen. Mit sichtlichem Spaß treibt der Regisseur das noch weiter: Erst nach der Konfrontation mit Elijah lernt David seine ständigen ESP-Flashes als mögliches Zeichen seiner besonderen Fähigkeiten zu erkennen. Ein In-Scherz am Rande: ein einziges Mal läuft er in die Irre und beißt sich die Zähne an Shyamalan selbst aus - der in diesem Cameo das gleiche Pokergesicht aufsetzt wie bei seiner Inszenierung. Gern würde man ihm da fast glauben, dass hier einer wirklich genussvoll in den künstlerisch beflissenen Ausläufern des Mainstreamkinos mit den Beschränkungen spielt, aber dann wirft er schon vor dem beknackten Ende alle Distanz und Ironie weg. Der Showdown wird zugkleistert mit dräuender Superheldenmusik, bis die letzte Drüse rinnt. Die Berechnung hat die Intelligenz links außen überrollt - aber was macht das schon, will man Unzerbrechlich dann noch wirklich bis in seine pathetische Konsequenz durchdenken: Sind wir nicht alle Superhelden, wenn wir gelernt haben uns ins Leben zu fügen?
lg Sandy
Es ist schon ein Weilchen her, dass ich mir diesen Film anbgeschaut habe. Aber ich hab ihn noch total gut im Gedächnis, so dass ich ihn hier vorstellen möchte ;)
Inhalt
Unmittelbar vor Philadelphia kommt es zu einem Zugunglück, das 131 Tote fordert. Nur ein Mann überlebt, ohne eine Schramme. Es ist David Dunn (Bruce Willis), Sicherheitsbeamter im städtischen Stadion. Zurück in seiner unglücklichen Existenz - die Ehe mit Audrey (Robin Wright) droht zu zerbrechen, die Beziehung zum gemeinsamen Sohn (Spencer Treat Clark) leidet nicht minder an seiner fast autistischen Traurigkeit - nimmt der von einer seltenen Knochenkrankheit Comic-Spezialist geplagte Elijah Price (Samuel L. Jackson) Kontakt mit ihm auf. Der glaubt in Dunn das Gegenstück zu seinem morschen Körper gefunden zu haben: Einen unzerbrechlichen Superhelden. David tut dessen Drängen zunächst als Spinnerei ab, doch die nagenden Fragen seines Gegenübers bringen ihn zum Nachdenken. Zuerst stellt David fest, dass er noch keinen Tag seines Diensts krank gemeldet war, dann scheint er beim Hanteltraining übermenschliche Kräfte zu besitzen. David forscht in der Vergangenheit, um die Gegenwart zu reparieren: War er wirklich nie verletzt? Ist er tatsächlich ein Superheld oder fällt er den Illusionen des charismatischen Comicnarren zum Opfer? Zugleich muss er auch im Privaten die Existenz neu bedenken: Seine Frau will die zerrüttete Ehe kitten, sein Sohn träumt vom geliebten Vater als Supermann. Schließlich stellt sich David seinen Ängsten...
Kritik
\"Ich habe so etwas noch nie gesehen.\" Erst, wo die Realität kippt, das Unfassbare die Banalität des Alltags überwältigt, kann das Kino von M. Night Shyamalan ansetzen. Ein Mann sitzt im Zug, auf der Heimreise von einem Vorstellungsgespräch. Eine zum Flirt tendierende Unterhaltung zerbröselt, dann sieht man ihn in Nahaufnahme: Er trägt das Gesicht von Bruce Willis, dem Verletzlichen unter den amerikanischen Actionstars.
Das Rattern des Zuges drängt sich nach vor, das Geräusch beschleunigt sich, der Held wendet den Kopf und sieht uns an: Etwas Schreckliches steht unmittelbar bevor.
Ein katastrophaler Zugunfall, der 131 Menschen das Leben kostet und nur den Helden, David Dunn, wie durch ein Wunder unverletzt zurücklässt, löst die Handlung von Unbreakable aus, doch nur die Folgen des Unglücks sind zu sehen. Unzerbrechlich heißt der Film, aber zerbrechlich, fragil wäre gerne seine Konstruktion, so wie das Innere seiner zweiten Hauptfigur, des Comic-Spezialisten Elijah Price (Samuel L. Jackson). Der leidet an einer seltenen Knochenkrankheit: Ein Sturz, ein heftiger Schlag und das Innere seines Körper wird aufs Neue zertrümmert - eine Rückblende entführt uns in seine einsame, ängstliche Jugend und eine Reflektion auf einem Fernsehschirm, die das Gespräch zeigt, in dem ihm seine Mutter (die wirklich nuancierte Darstellung des Films: Charlayne Woodward) zum Trost das erste Comic anbieten wird. Die Welt der bunten Hefte, das hat uns schon zu Anfang ein Zwischentitel angekündigt, ist eine mächtige, einflussreiche. Elijah verfällt ihr, analysiert sie, baut sie neu: \"Eine klassische Darstellung des Kampfes von Gut und Böse\", erläutert er eine Zeichnung im seltsam leblosen Bewunderungsareal seiner Comic-Kunstgalerie mit dem passenden Namen Limited Edition: Schatten und Licht, Schwarz und Weiß - da in der Welt der Superheldencomics alles seine Entsprechung findet, vermeint er in David Dunn auch endlich sein positives Spiegelbild gefunden zu haben: Das Gegenteil seines spröden Knochenbaus, der unverletzte Überlebende, unzerbrechlich eben.
David glaubt noch nicht an seine Bestimmung: Den Überzeugungsversuchen Elijahs, dem Jackson, abseits seiner festgefahrenen Rollenschiene mit einem ganzen Arsenal stilisierten Zubehörs (klackender Stock, Stachelbeinprothese, stechender Blick unter schiefer Frisur, die selbstgefällige, ruhelose Diktion eines Zynikers) tatsächlich etwas genuin Obsessives zu verleihen mag, ist der Großteil des Films gewidmet. Security Man: Ein ominöser Schattenriss im Stadion, umweht von seiner Arbeitsuniform. Was für den Zuschauer von Anfang an zu sehen ist, muss Dunn erst realisieren. Und so widmet sich Unbreakable im Detail der Rekonstruktion einer nicht erinnerten Vergangenheit: Keine Krankheit in fünf Dienstjahren, keine Verletzung, die der genauen Rückschau standhalten würde.
Der Film auch nicht: Unbreakable markiert für den Regisseur einen deutlichen Fortschritt gegenüber seinem Vorgängerfilm Der Sechste Sinn. Im Visuellen strebt Shyamalan eine Annäherung an die Comic-Welten an, die seine Erzählung unterfüttern: Blockierte Einstellungen wie aus den Panels der Hefte, wobei Objekte im Vordergrund Figuren verbergen; Rahmen im Bildrahmen, bevorzugt als Einstellung auf spiegelnde Oberflächen, das leere Bewusstsein eines endlosen Referenzsystems. Viele Zutaten sind dieselben wie letztes Jahr - ein feuchtes, dröges Philadelphia, hinter dessen trostlosen Fassaden ein fast autistischer Held den Frieden mit seiner Bestimmung finden muss, eine zerborstene Kleinfamilie, vom Kommunikationszusammenbruch getrennt. Shyamalans Filme sind Heilsgeschichten, die den Nukleus des Kleinbürgertums wieder kitten: Robin Wright Penn als Dunns Ehefrau, die hinter einem überdimensionalen Cocktailglas einen Neubeginn der auseinander gelebten Beziehung anstrebt, und Spencer Treat Clark als Sohn, dem der Wunschtraum vom Vater als Superhelden eine zweite Chance auf eine funktionierende Kindheit ermöglicht, bleiben dennoch nur Anhängsel, Füllmaterial, das das Erfolgsrezept des Vorgängers neu gruppiert, verfeinert, aber nicht erweitert. Weniger New-Age-befrachtet als in Der Sechste Sinn versteifen sich Shyamalans visuelle Metaphern einmal mehr auf die Feier des heilenden Verständnisses unter der Entfremdung in der modernen Welt (deren Ursachen unbegründet, bloße Symptome bleiben). Auch wenn die Handlung immer ambivalent sein soll, wird am Schluss alles in eine niedliche Spielberg-Welt zusammengeführt, in der die emotionale Auflösung die Beschäftigung mit den Problemen ersetzt.
Unzerbrechlich baut den Superheldenmythos als Kunstfilm neu - das behäbige Tempo, die fein texturierten Bilder, die betont symmetrisch gebauten Handlungsfäden verdecken nicht, dass hier alte Säcke als des Kaisers neue Kleider verkauft werden. (Auch die bewussten Doppelungen rauben dem Familiensubplot die Kraft, abgesehen von seiner Wiedererkennbarkeit: Als das Gegenstück zur wesentlich weniger breitgetretenen Beziehung von Elijah zu seiner Mutter wirkt er nur noch prätentiös wie vieles hier.)
Dabei passt die Comicwelt eigentlich viel besser zu Shyamalans Verklärung banaler Inhalte, auch wenn sich gelegentlich der unangenehme Verdacht aufdrängt, dass im neuen Film auch noch der andere Totengräber des populären Kinos, George Lucas, integriert wird: Hier wird jetzt die Privatmythologie zur restaurativen Glückseligkeit gezimmert. Die, ist, nicht zuletzt dank Jackson nicht ohne Reiz. (Willis hingegen ist ganz wie im Sechsten Sinn leider durch die Anforderungen der Rolle auf ein schwermütiges Starren beschränkt - vom großen körperlichen Schauspieler, der ohne viel Worte in Twelve Monkeys eine geradezu existenzielle Darstellung erreichte, ist wieder nichts zu spüren.) Jackson und der Regisseur tragen hier wirklich eine persönliche Besessenheit in die Welt: Die Monologe des Schauspielers zeigen Leidenschaft für das Thema, Shyamalan setzt nicht nur im Bildaufbau (man wartet darauf, dass die im schläfrigen Tempo hervorgewisperten Sätze wie Sprechblasen über den Figuren erscheinen), sondern auch in der Story und weiteren Gestaltungsmitteln (Zwischentitel als Prolog und Epilog) auf Verwandtschaft zum gern belächelten Genre (und erweist ihm im Aufbürden der Gewichtigkeit einen Bärendienst). Nicht zufällig spielt die beste Szene von Unzerbrechlich in einem Comic-Shop. Wortlos starrend sitzt Elijah in seinem Rollstuhl im hintersten Gang, eine enttäuschende Pixies-Coverversion nervt aus dem Radio, ein sichtlich unsicherer Angestellter will den schweigsamen Gast vor Ladenschluss hinausbugsieren. Ein rollender Kampf einen Gang hinunter, auf den Zuschauer zu: Elijah verdreht immer wieder die Räder seines Stuhls, kracht sprachlos gegen Regale, wirft die Ständer um. Vor der Hingabe dieses Mannes entsteht ein kaltes Unbehagen, das der Rest des Films nie wieder einfängt. Blöderweise endet die Szene dann doch wieder in einem Hinweis - wie schon zuletzt baut Shyamalan seinen Film auf einen Überraschungseffekt hin, scheinbar um kommerziellen Erwägungen gerecht zu werden, und diesmal beißt er sich wirklich in den Schwanz: Einen dümmeren Schluss hat man das ganze Jahr nicht gesehen.
Verraten wird er natürlich nicht (soll sich jeder selber ärgern) und eigentlich ist er logisch zwingend: Eine der Qualitäten von Unzerbrechlich ist nämlich ein stark ausgeprägter Sinn fürs Lächerliche, das kaltschnäuzig dramatisch präsentiert wird. Der Symbolik Shyamalans haftet diesmal die simple Schwarzweißmalerei der meisten frühen Comic-Universen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wenn Elijah stürzt, und sein Stock in tausend Stücke bricht, um den Vorgang im Innern seines Körpers zu versinnbildlichen, hat die banale Entsprechung fast schon wieder komische Qualität - es ist auf jeden Fall wesentlich weniger ärgerlich als die überangestrengte Aufdringlichkeit, mit der im Sechsten Sinn - oh, Symbol entschwundener Jugend - ein roter Ballon fast ebenso lang zur Decke hinaufsteigen schien, wie das Kindheitstrauma, das er repräsentieren sollte, dauerte. Mit der Zeit reizt Shyamalan die neugefundene Möglichkeit bis zum Anschlag aus: Eine Familienszene am Küchentisch, die vom Gefährlichen ins Lachhafte kippt, enigmatische Stehsätze, die im Kontext nur mehr befremden: \"Wasser ist dein Kryptonit\", \"Aber die Liebe währt ewiglich\" usw.
Selbst die Story macht keinen Hehl daraus, dass sie an den Haaren herbeigezogen ist: Realisiert man es tatsächlich nicht, dass man sein Leben lang nie krank oder verletzt war? Unwahrscheinlich - wie vieles in Unzerbrechlich gibt sich der Auslöser als reine Konstruktion zu erkennen. Mit sichtlichem Spaß treibt der Regisseur das noch weiter: Erst nach der Konfrontation mit Elijah lernt David seine ständigen ESP-Flashes als mögliches Zeichen seiner besonderen Fähigkeiten zu erkennen. Ein In-Scherz am Rande: ein einziges Mal läuft er in die Irre und beißt sich die Zähne an Shyamalan selbst aus - der in diesem Cameo das gleiche Pokergesicht aufsetzt wie bei seiner Inszenierung. Gern würde man ihm da fast glauben, dass hier einer wirklich genussvoll in den künstlerisch beflissenen Ausläufern des Mainstreamkinos mit den Beschränkungen spielt, aber dann wirft er schon vor dem beknackten Ende alle Distanz und Ironie weg. Der Showdown wird zugkleistert mit dräuender Superheldenmusik, bis die letzte Drüse rinnt. Die Berechnung hat die Intelligenz links außen überrollt - aber was macht das schon, will man Unzerbrechlich dann noch wirklich bis in seine pathetische Konsequenz durchdenken: Sind wir nicht alle Superhelden, wenn wir gelernt haben uns ins Leben zu fügen?
lg Sandy
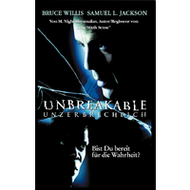
Bewerten / Kommentar schreiben