Das weiße Rauschen (DVD) Testbericht
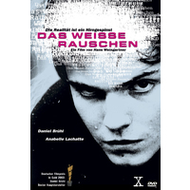
ab 78,52 €
Billiger bei eBay?
Bei Amazon bestellen
Paid Ads from eBay.de & Amazon.de
Auf yopi.de gelistet seit 10/2004
Auf yopi.de gelistet seit 10/2004
Erfahrungsbericht von wildheart
Versuch der Annäherung an Schizophrenie
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
In einem Interview (1) äußerte Regisseur Hans Weingartner, er habe mit seinem Film das Thema Schizophrenie nicht wie in anderen Filmen aufgrund von Effekthascherei ausschlachten oder seinen Betroffenen als psychopathischen Serienkiller oder wahnwitziges Genie zeigen wollen,. Vielmehr wollte er darstellen, wie allein oft Betroffene dieser Krankheit seien und von ihrer Umwelt weder verstanden würden, noch sich jemand Zeit für sie nehme.
Inhalt
Der 21jährige Lukas (Daniel Brühl) kommt endlich aus seiner kleinstädtischen Heimat heraus in die Großstadt. Er zieht zu seiner Schwester Kati (Anabelle Lachatte) in eine WG, in der sie mit ihrem Freund Jochen (Patrick Joswig) lebt. Lukas träumt von Unabhängigkeit und lustvollem Leben. Und so scheint es auch zu beginnen. Partys, ein bisschen Drogen, und die erste Frau, mit der er sich zu einem Kinoabend verabredet. Doch als die Kinokassierin erklärt, der Film »Taxi Driver« laufe an diesem Abend nicht, beschimpft Lukas sie auf die übelste Weise. Seine neue Bekannte (Katharina Schüttler) ist entsetzt, und flieht vor Lukas.
Nach einem Ausflug, den Kati und Jochen für Lukas organisieren, um ihn wieder aufzumuntern, sind alle vom Genuss psychedelischer Pilze auf dem Trip. Doch während Kati und Jochen am nächsten Tag wieder in Ordnung sind, beginnt für Lukas ein dauerhafter Trip. Plötzlich hört er Stimmen, laut, deutlich. Auch überlaute Musik lässt sie nicht verschwinden. Zunächst nimmt er an, seine Schwester und Jochen würden über ihn reden, ja, wollten ihn möglicherweise fertig machen. Er geht auf Jochen los. Und später springt er aus dem Fenster.
Lukas landet in der Psychiatrie. Die Diagnose des Arztes (Michael Schütz) ist eindeutig: Schizophrenie ...
Inszenierung
Was anfängt, wie der etwas unbeholfene Beginn eines neuen Lebensabschnitts, wie eine leicht komödienhaft wirkende Geschichte eines jungen Mannes, der sich in der Großstadt, mit dem Verhältnis zu Frauen, mit dem Studium erst einmal zurechtfinden muss, geht fast von einem Augenblick zum nächsten über in einen Horrortrip. Der Dogma-ähnlich gedrehte Film, mit oft drei Digitalkameras gleichzeitig aufgenommen, lässt den Zuschauer in eine Welt hineinfallen, die vom immer dramatischer werdenden Zustand des Lukas beherrscht ist. Zwar verschaffen ihm Medikamente kurzfristig sichtbare Besserung, so dass er sogar arbeiten gehen kann, doch Lukas will das Zeug nicht weiternehmen, sucht nach einem Weg, mit seiner Krankheit anders zu leben als in ständiger medikamentös bedingter Schläfrigkeit und Mattheit.
Dass die (möglicherweise auch sozialisationsbedingten) Hintergründe der Krankheit nur angedeutet werden, war für mich weniger ein Problem. Lukas Mutter hatte sich nach mehreren Aufenthalten in der Psychiatrie umgebracht, als Kati vier Jahre alt war. Die Kinder wuchsen bei den Großeltern auf. Es heißt, Schizophrenie trete verstärkt in sozialen Strukturen auf, in denen Einsamkeit, Isoliertheit, Beziehungslosigkeit vorherrsche.
Daniel Brühl kann sich in exzellenter Weise in seine schizophrene Rolle vertiefen. In Verbindung mit der eingesetzten Technik und Brühl als Hauptdarsteller schafft Weingartner eine intensive Sensibilisierung des Zuschauers für eine Krankheit, über die immer noch sehr wenig bekannt ist. Der Film ist nicht kunstvoll oder gar künstlich inszeniert, spielt selten mit dramatisierenden Effekten, sondern hat fast dokumentarischen Charakter. Die Nähe der Kameraführung am Gegenstand, am Kranken, an seiner Hilflosigkeit, seinen Selbstrettungsversuchen, seinem Widerstand gegen seine Schizophrenie und seiner Verzweiflung zwingt den Betrachter in hautnahe Tuchfühlung zum Kranken und zur Krankheit.
Diese Art der Inszenierung hat große Vorteile, denn sie wirkt weder plakativ oder überdramatisiert, noch aufgesetzt oder aufdringlich. Doch zugleich fehlt dem Film damit auch das Überraschende, das Verstörende angesichts der Verstörung durch die Konfrontation mit der Krankheit. Der Film läuft und läuft und läuft entlang der Krankheit und des Kranken. »Das weiße Rauschen« verhaftet nicht am Gegenstand in Form eines ärztlichen Patientenprotokolls, aber der Film wächst über den Gegenstand auch nicht hinaus. Der allzu »nahen Nähe« fehlt manchmal die aufatmende Distanz zum Gegenstand, der Schritt (nicht nur mit der Kamera) zurück, das einhaltgebietende »Moment mal«.
Fazit
»Das weiße Rauschen« ist ein überraschend schöner und erschreckender Streifen, dem es gelingt, ein tiefes Mitgefühl für den kranken Lukas zu erzeugen. Doch es zeigte sich mir auch, dass der fehlende Abstand zu einem derart schwierigen Thema (einer für die Betroffenen schicksalhaften Krankheit wie Schizophrenie) die tiefe Verbundenheit des Betrachters letztlich ins Leere laufen lässt. Die exzellente Darstellung des Lukas durch Daniel Brühl und auch die engagiert-sympathische Rolle, die Anabelle Lachatte als Lukas liebende Schwester spielt, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film fast schon platt, unangemessen – wie viele Road-Movies – endet: am Meer.
(1) Siehe das Interview mit Hans Weingartner in: Dirk Jasper Filmlexikon unter der Adresse: www.dem.de/entertainment/stars/h/hans_weingartner_i_01.html.
Das weiße Rauschen
Deutschland 2001, 100 Minuten
Regie und Drehbuch: Hans Weingartner
Hauptdarsteller: Daniel Brühl (Lukas), Anabelle Lachatte (Kati), Patrick Joswig (Jochen), Karl Danguillier (Jesus), Katharina Schüttler (Kinodate), Ilse Strambowski (Kinokassiererin), Michael Schütz (Psychiater), Michael Lentz (Opa), Claudia Bach (Mädchen im Zug), Marek Goldowski (Pfleger)
© Ulrich Behrens 2002
(dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in www.ciao.com unter dem Mitgliedsnamen Posdole)
Inhalt
Der 21jährige Lukas (Daniel Brühl) kommt endlich aus seiner kleinstädtischen Heimat heraus in die Großstadt. Er zieht zu seiner Schwester Kati (Anabelle Lachatte) in eine WG, in der sie mit ihrem Freund Jochen (Patrick Joswig) lebt. Lukas träumt von Unabhängigkeit und lustvollem Leben. Und so scheint es auch zu beginnen. Partys, ein bisschen Drogen, und die erste Frau, mit der er sich zu einem Kinoabend verabredet. Doch als die Kinokassierin erklärt, der Film »Taxi Driver« laufe an diesem Abend nicht, beschimpft Lukas sie auf die übelste Weise. Seine neue Bekannte (Katharina Schüttler) ist entsetzt, und flieht vor Lukas.
Nach einem Ausflug, den Kati und Jochen für Lukas organisieren, um ihn wieder aufzumuntern, sind alle vom Genuss psychedelischer Pilze auf dem Trip. Doch während Kati und Jochen am nächsten Tag wieder in Ordnung sind, beginnt für Lukas ein dauerhafter Trip. Plötzlich hört er Stimmen, laut, deutlich. Auch überlaute Musik lässt sie nicht verschwinden. Zunächst nimmt er an, seine Schwester und Jochen würden über ihn reden, ja, wollten ihn möglicherweise fertig machen. Er geht auf Jochen los. Und später springt er aus dem Fenster.
Lukas landet in der Psychiatrie. Die Diagnose des Arztes (Michael Schütz) ist eindeutig: Schizophrenie ...
Inszenierung
Was anfängt, wie der etwas unbeholfene Beginn eines neuen Lebensabschnitts, wie eine leicht komödienhaft wirkende Geschichte eines jungen Mannes, der sich in der Großstadt, mit dem Verhältnis zu Frauen, mit dem Studium erst einmal zurechtfinden muss, geht fast von einem Augenblick zum nächsten über in einen Horrortrip. Der Dogma-ähnlich gedrehte Film, mit oft drei Digitalkameras gleichzeitig aufgenommen, lässt den Zuschauer in eine Welt hineinfallen, die vom immer dramatischer werdenden Zustand des Lukas beherrscht ist. Zwar verschaffen ihm Medikamente kurzfristig sichtbare Besserung, so dass er sogar arbeiten gehen kann, doch Lukas will das Zeug nicht weiternehmen, sucht nach einem Weg, mit seiner Krankheit anders zu leben als in ständiger medikamentös bedingter Schläfrigkeit und Mattheit.
Dass die (möglicherweise auch sozialisationsbedingten) Hintergründe der Krankheit nur angedeutet werden, war für mich weniger ein Problem. Lukas Mutter hatte sich nach mehreren Aufenthalten in der Psychiatrie umgebracht, als Kati vier Jahre alt war. Die Kinder wuchsen bei den Großeltern auf. Es heißt, Schizophrenie trete verstärkt in sozialen Strukturen auf, in denen Einsamkeit, Isoliertheit, Beziehungslosigkeit vorherrsche.
Daniel Brühl kann sich in exzellenter Weise in seine schizophrene Rolle vertiefen. In Verbindung mit der eingesetzten Technik und Brühl als Hauptdarsteller schafft Weingartner eine intensive Sensibilisierung des Zuschauers für eine Krankheit, über die immer noch sehr wenig bekannt ist. Der Film ist nicht kunstvoll oder gar künstlich inszeniert, spielt selten mit dramatisierenden Effekten, sondern hat fast dokumentarischen Charakter. Die Nähe der Kameraführung am Gegenstand, am Kranken, an seiner Hilflosigkeit, seinen Selbstrettungsversuchen, seinem Widerstand gegen seine Schizophrenie und seiner Verzweiflung zwingt den Betrachter in hautnahe Tuchfühlung zum Kranken und zur Krankheit.
Diese Art der Inszenierung hat große Vorteile, denn sie wirkt weder plakativ oder überdramatisiert, noch aufgesetzt oder aufdringlich. Doch zugleich fehlt dem Film damit auch das Überraschende, das Verstörende angesichts der Verstörung durch die Konfrontation mit der Krankheit. Der Film läuft und läuft und läuft entlang der Krankheit und des Kranken. »Das weiße Rauschen« verhaftet nicht am Gegenstand in Form eines ärztlichen Patientenprotokolls, aber der Film wächst über den Gegenstand auch nicht hinaus. Der allzu »nahen Nähe« fehlt manchmal die aufatmende Distanz zum Gegenstand, der Schritt (nicht nur mit der Kamera) zurück, das einhaltgebietende »Moment mal«.
Fazit
»Das weiße Rauschen« ist ein überraschend schöner und erschreckender Streifen, dem es gelingt, ein tiefes Mitgefühl für den kranken Lukas zu erzeugen. Doch es zeigte sich mir auch, dass der fehlende Abstand zu einem derart schwierigen Thema (einer für die Betroffenen schicksalhaften Krankheit wie Schizophrenie) die tiefe Verbundenheit des Betrachters letztlich ins Leere laufen lässt. Die exzellente Darstellung des Lukas durch Daniel Brühl und auch die engagiert-sympathische Rolle, die Anabelle Lachatte als Lukas liebende Schwester spielt, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film fast schon platt, unangemessen – wie viele Road-Movies – endet: am Meer.
(1) Siehe das Interview mit Hans Weingartner in: Dirk Jasper Filmlexikon unter der Adresse: www.dem.de/entertainment/stars/h/hans_weingartner_i_01.html.
Das weiße Rauschen
Deutschland 2001, 100 Minuten
Regie und Drehbuch: Hans Weingartner
Hauptdarsteller: Daniel Brühl (Lukas), Anabelle Lachatte (Kati), Patrick Joswig (Jochen), Karl Danguillier (Jesus), Katharina Schüttler (Kinodate), Ilse Strambowski (Kinokassiererin), Michael Schütz (Psychiater), Michael Lentz (Opa), Claudia Bach (Mädchen im Zug), Marek Goldowski (Pfleger)
© Ulrich Behrens 2002
(dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in www.ciao.com unter dem Mitgliedsnamen Posdole)
17 Bewertungen, 3 Kommentare
-

02.07.2010, 10:01 Uhr von XXLALF
Bewertung: besonders wertvollmit dem film könnte ich mich auch anfreunden wobei mich wahrscheinlich die verzweiflung packen würde, warum um alles in der welt kann ich diesem kranken jungen nicht helfen. muss ein sehr erschütternder,wie auch wunderschöner film sein. sehr schöner bericht, bw und ganz liebe grüße
-

29.09.2007, 21:54 Uhr von Puenktchen3844
Bewertung: sehr hilfreichEin ausführlicher Bericht. LG
-

15.12.2006, 12:26 Uhr von Sayenna
Bewertung: sehr hilfreichsh & Kuss :-)
Bewerten / Kommentar schreiben